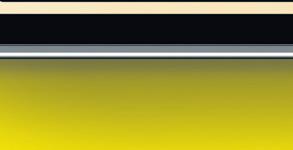FA LTER DIE WOCHENZEITUNG AUS WIEN NR. 34 / 22 – 24. AUGUST 2022 MIT 56 SEITEN FALTER : WOCHE ALLE KULTURVERANSTALTUNGEN IN WIEN UND ÖSTERREICH TERMINE VON 26.8. BIS 1.9. Falter mit Falter: Woche Falter Zeitschri en GmbH, Marc-Aurel-Straße 9, 1011 Wien WZ 02Z033405 W Österreichische Post AG Retouren an Postfach 555, 1008 Wien laufende Nummer 2865/2022 € 4,90 34 9 004654 046675 ANZEIGE Eisen trägt zu einer normalen kognitiven Funktion bei. PERFORMEN MIT DURCHBLICK? Nahrungsergänzungsmittel ohn n FOTO: CHRISTOPHER MAVRI Č STURM UND DRAG Drag Queens sind mehr als Männer in Frauenkleidern. Über eine Kunstform, die gerade massentauglich wird. Besonders in Wien























SLOWENIEN. MEINE ART DEM ALLTAG ZU ENTFLIEHEN. #ifeelsLOVEnia #myway #sloveniaculture www.slovenia.info aut historic falter print ad 216x315 aug22.indd 1 23/08/2022 09:05
FALTER & MEINUNG
4 Leserbriefe 5 Armin Thurnher 6 Matthias Dusini, Franz Kössler, Martin Staudinger 8 P.M. Lingens, Impressum 9 Isolde Charim, Melisa Erkurt
POLITIK
11 Teil 3 der Trilogie: die mächtigen Männer hinter der Cofag 14 Abgeschoben: der Fall Tina und seine Folgen 16 Tassilo Wallentin, der Präsidentschaftskandidat der Krone
17 Der Ökonom Sergej Guriev im Interview: Die Sanktionen gegen Russland wirken!
18 Wissenschaft: Die neue Normalität der heißen Sommer
MEDIEN
20 Die Evolution der sozialen Netzwerke 22 Das politische Buch
FEUILLETON
24 Schriftsteller Norbert Gstrein im Gespräch 27 TV-Serie: „House of the Dragon“ 28 Neuer Wien-Pop: Oehl und Sophia Blenda 30 Neue Bücher, neue Platten 31 AntisemitismusDebatte: Mena-WatchGründer Erwin Javor 32 FeuilletonSchlussseite
STADTLEBEN
34 Nische oder Mainstream: die bunte Wiener Dragszene 38 Falter-FreibadSommerserie im Strandbad Alte Donau 39 Kulinarischer Rundgang um selbiges Freibad 40 Noch eine Hotelbar, mit reichlich Attitüde und Ausblick 41 Mit frischer Minze geht Rehragout auch im Sommer
NATUR
43 Mehr Raum für Flussbetten. Was Renaturierung für Biodiversität und Hochwasserschutz tun kann
KOLUMNEN
46–47 Phettbergs Predigtdienst, Doris Knecht, Heidi List, Fragen Sie Frau Andrea
Vom Recht zu bleiben
Die Abschiebung der Wiener Schülerin Tina war laut Höchstgericht gesetzeswidrig. In der Praxis wird das nichts ändern.
Land am Strome
Die Regulierung der Flüsse ist ein Problem. Wer Gewässern ihren Lauf lässt, tut etwas gegen Hochwasser und für Biodiversität.
Wenn es bunt sein soll, ruf Mavrič an. Für die große Stadtleben-Reportage dieser Ausgabe hat der Falter-Fotograf Christopher Mavri č die Wiener Drag-Szene porträtiert. Schönes Cover inklusive. SEITE 1, 34
Ob Ikea, Lastenräder oder Sommerausflugstipps – als Falter.Morgen-Praktikant zeigt Simon Steiner gerade, dass ihm jedes Thema liegt. Diese Woche taucht er gekonnt in die Welt der Wissenschaft. SEITE 18
Der Musik- und Literaturkritiker Sebastian Fasthuber interviewte den Schriftsteller Norbert Gstrein über seinen neuen Roman und porträtierte die Musiker Ari Oehl und Sophia Blenda. SEITE 24, 28



Falscher Berg In der sommerlichen Freibad-Serie haben wir im Falter 32/22 das Favoritner Laaerbergbad porträtiert. Der Autor betonte die Höhenlage und behauptete selbstsicher, man könne vom Bad aus das Kalkalpen-Massiv Rax sehen. Dabei handelt es sich um einen weit verbreiteten Irrglauben, bei gutem Wetter reicht der Blick aber immerhin bis zum Schneeberg. Besten Dank an unseren weitsichtigen Leser Karel Kriz.

Genuschelte Reime

Heiterkeit als Rezept gegen die Angst: die Wiener Musikerin und Songwriterin Sophia Blenda stellt ihr neues Album vor.

Kabarett in der FALTER : WOCHE
Von TikTok auf die Bühne: Juristin Irina alias Toxische Pommes gibt ihr KabarettDebüt im Stadtsaal Wien. Ein Gespräch.
Nachrichten aus dem Inneren Wir über uns
W
ir nennen sie „Um den Block“-Gehen, jene Bewegungstätigkeit, die müde Hirne wieder erfrischen soll. Dabei kann es passieren, dass man andere Kollegen an gar unerwarteten Orten trifft, außerhalb ihres natürlichen Habitats sozusagen. So geschehen am vergangenen Montag, als die Autorin dieser Zeilen plötzlich des Feuilletonchefs Matthias Dusini in einer Trafik gewahr wurde. Wollte der Mann verstohlen Zigaretten kaufen? Weit gefehlt. Er hat sein „Schatzsuche“-Lotterie-Los gegen drei Euro Gewinn eingetauscht.
Einen zugegebenermaßen größeren Gewinn kann die Falter-Redaktion verlautbaren. Mit Daniela Krenn haben wir endlich eine Verstärkung für das Stadtleben-Ressort gefunden. Für den Job beim Falter hat Daniela sogar den Meerzugang eingetauscht. Wobei Greifswald an der deutschen Ostsee liegt, mediterranes Flair kommt da nicht auf. Dann schon besser in Wien im Hochsommer arbeiten. Am Donaukanal, im Club U und zum ersten Mal im Krapfenwaldlbad war Daniela dann auch schon. Der Besuch beim Heurigen steht noch aus. Daniela kommt vom Magazin Katapult, ist 33 Jahre alt und hat gleich einmal die Covergeschichte hingelegt. Herzlich willkommen! Und falls jemand von einer Wohnung weiß: Das ist das Einzige, was Daniela noch fehlt. EVA KONZETT


Aus dem Verlag Neu und aktuell
Fuchs im Bau Kunstlehrer Hannes Fuchs tritt nach einem persönlichen Rückschlag eine neue Stelle in einer Wiener Gefängnisschule an. Dort soll er die eigenwillige Pädagogin Elisabeth Berger ablösen, lernt zuvor aber noch ihre unkonventionellen Methoden kennen. 138 min, € 14,99, faltershop.at
INHALT : WIR ÜBER UNS FALTER 34/22 3
PORTRÄT-FOTOS KOLUMNEN UND KOMMENTARE IM HEFT: KATHARINA GOSSOW; FOTOS: ROBERT NEWALD/PICTUREDESK.COM, HERIBERT CORN, GEMEINFREI, MUHASSAD AL-ANI
28
43
14
4
Köpfe der Woche Autorinnen und Autoren dieser Ausgabe
Errata Unsere Fehler
Post an den Falter
Wir bringen ausgewählte Leserbriefe groß und belohnen sie mit einem Geschenk aus dem Falter Verlag. Andere Briefe erscheinen gekürzt. Bitte geben Sie Ihre Adresse an. An: leserbriefe@falter.at, Fax: +43-1-53660-912 oder Post: 1010 Wien, Marc-Aurel-Straße 9
Betrifft: „Überfordert? Überfördert!“, von E. Konzett, Falter 33/22 Danke für die Hintergründe rund um die Cofag. Ich finde es ja grundsätzlich richtig, dass die Wirtschaft während der Pandemie unterstützt wurde. Wenn man jetzt aber schwarz auf weiß liest, wie viel alles gekostet hat und

en) konnten nie ins Homeoffice gehen und waren insbesondere in der ersten Zeit, als es noch keine FFP2-Masken, Impfungen oder generell Wissen über die Krankheit gab, immer an vorderster Front – und trotzdem können wir ihnen ihr Engagement nicht entsprechend vergüten und einen Bonus auszahlen o. Ä., weil es sich einfach finanziell nicht ausgeht.
Die Autorin ist Obfrau des Konsumvereins Schnifis in Vorarlberg
v. a. wer großzügigste Leistungen bekommen hat, OBWOHL sie Gewinne geschrieben haben, das ist echt bitter!
Gegenbeispiel dazu: Ich bin die Obfrau eines kleinen Nahversorgers in Vorarlberg. Wir kämpfen auch ohne Pandemie ständig um Mitarbeiter und das finanzielle Überleben generell. Als Lebensmittelhändler waren wir nie vom behördlichen Zusperren betroffen, hatten kurzfristig sogar Umsatzsteigerungen und konnten somit um keine Förderungen ansuchen. Unsere Mitarbeiterinnen (natürlich alles Frau-
FALTER MEDIA
FALTER V E RLAG DIE BESTEN SEITEN ÖSTERREICHS
MAG.(FH) SABINE DUELLI 6822 Schnifis

Betrifft: „Putins Griff nach dem Balkan“ von N. Brnada, Falter 32/22 Orthodoxe, Muslime und Katholiken, ein Nationalismus, dessen Wurzeln in die militärischen Auseinandersetzungen der damaligen Großmächte des zaristischen Russlands, des Osmanischen Imperiums und des Reichs der Habsburger zurückreichen, Menschen, die von beiden Weltkriegen viele Traumata mitnahmen, die in der Zeit Jugoslawiens konserviert wurden, vermengt mit regionalen Konflikten, die bis in die familiären Strukturen hineingreifen, eine innerliche Befindlichkeit, die beim Zerfall Jugoslawiens die Konflikte zum Krieg eskalieren lassen – mit allen denkbaren Grausamkeiten, bis hin zu ethnischen Säuberungen.
„Es braucht nur irgendwo ein Attentat erfolgen, eine Bombe hochgehen …, dass Menschen ... Milizen gründen, Checkpoints errichten, Zivilisten sich bewaffnen“ (Gerald Knaus, Balkan-Kenner). Für die heutigen Großmächte, das postsowjetische Russland, die EU und China, ist die Notlage der Menschen am Westbalkan, wie es scheint, wiederum nur eine Aufgabe, deren Lösung von den eigenen Interessen bestimmt wird. Für mich, den Leser dieses Berichts, tut sich hier kein Hoffnungsschimmer auf.
KLAUS NEMETZ Wien 10

Betrifft: Urbanismus-Kolumne von L. Paulitsch, Falter 32/22 Diese Urbanismus-Kolumne spricht aus vielen erholungssuchenden Seelen an der Unteren Alten Donau! Die Zwangsbeschallung aus allen Richtungen belästigt. Sind Kopfhörer noch nicht erfunden? Plärrende Musik aus Verstärkern ist in einem Erholungs- und Naturgebiet nicht „ortsüblich“. Ortsüblich sind allenfalls das Quaken der Frösche und fröhlicher Bade„lärm“.
R adi o
www.falter.at/radio
Der Podcast mit Raimund Löw www.falter.tv
Bereits online
Über den Menschen in der Opferrolle. Der Gerichtspsychiater Reinhard Haller setzt sich mit den Veränderungen und Facetten des Bewusstseins von Opfern auseinander. Ein Vortrag der Disputationes bei den Salzburger Festspielen
Als inhabergeführtes Medienhaus verlegen wir zahlreiche hochwertige Zeitschriften, Bücher, Magazine und Corporate Publishing-Produkte und betreiben eine Vielzahl an Websites, Onlineshops und Apps. Starke Marken, hohe publizistische Qualität sowie Verlässlichkeit und Engagement im Umgang mit unseren Mitarbeitern und Kunden zeichnen uns aus.
Für den Unternehmensbereich Corporate Publishing suchen wir für unseren Standort in der Wiener Innenstadt eine/n
Redakteur:in (w/m/d)
Sie kommen mit komplexen sozialen und produktionstechnischen Situationen zurecht, können sich auf eine Ihnen unbekannte Materie rasch einstellen und mit Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten und Institutionen kommunizieren, um daraus Geschichten zu machen, die gut zu lesen sind, aber auch den Wünschen der Interviewten entsprechen?
Sie sind es gewohnt, selbstständig und kundenorientiert aufzutreten und wollen mit unseren Kund:innen engagiert Inhalte erarbeiten und kreativ umsetzen?
Sie können schreiben (nicht nur in sozialen Medien), haben Humor und kommen mit Kolleg:innen gut zurecht?
Dann haben wir einen spannenden, herausfordernden Job für Sie!
Wir bieten flexible Arbeitszeiten mit Home-Office-Möglichkeit, ein wertschätzendes Umfeld und zahlen für diese Position je nach Berufserfahrung ein Bruttomonatsgehalt von mindestens € 2.400.– für 30 Wochenstunden.
Wenn Sie Interesse haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per Mail an magazine@falter.at
Ich weiß nicht, warum sich die „Erzählung“ von Ruhezeiten nach einer Uhrzeit so hartnäckig hält und von allen (auch der Polizei) wiederholt wird. Der missverständliche Hinweis auf Ruhe in der Nacht auf angebrachten Schildern „rechtfertigt“ geradezu das Lärmen tagsüber, insbesonders das quälende Wumm-Wumm aus Verstärkern auf den Stegen, Booten und Wegen. Bei Schönwetter ergibt das, wie Sie treffend beschreiben, eine DiskoDauerbeschallung, die weder ortsüblich noch angemessen ist.
EVA POSCH-BLEYER Wien 21

Betrifft: „ ... wie man einen Staat ausnimmt“ von A. Thurnher, Falter 33/22 Im Leitartikel von s. g. Herrn Armin Thurnher versteigt sich der Autor zu „... das Bereicherungsprinzip überwiegt, diese Triebfeder beinahe aller privaten Unternehmungen ...“. Nicht etwa „Gewinnerzielungsabsicht“, nein, „Bereicherung“ geistert durch seinen Kopf, wenn er an private Unternehmen denkt. Dass man aus den Gewinnen Wachstumsinvestitionen zu finanzieren hat, weiß er nicht(?), zweitens ist Wachstum ja eh schlecht. Aber in Wohlstand leben wollen er und seinesgleichen vermutlich doch.

Zur Klarstellung: Im Zivilrecht kennzeichnet der Begriff Bereicherung einen Vermögenszuwachs, der ohne rechtliche Grundlage auf Kosten eines anderen erlangt worden ist. Wer durch eine Bereicherung einen Vermögenszuwachs erhält, ist dem durch die Bereicherung Benachteiligten zur Herausgabe verpflichtet. Will Thurnher das? Dann möge er es klar schreiben und auch auf die Konsequenzen für unser Sozialsystem hinweisen, wenn keine Zahler mehr da sein werden.
WOLFGANG BAUER Wien 18
Bereits online
Medienmanager Gerhard Zeiler über den Präsidentschaftswahlkampf, die Nato und darüber, wie eine Ampel mit SPÖ, Grünen und Neos Österreich erneuern könnte. Mit Eva Konzett und Raimund Löw
Donnerstag, 24.8.
Der EU-Experte Stefan Lehne über die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Bleibt die Europäische Union angesichts der aggressiven Atommacht Russland geeint? Mit der Journalistin Magdalena Kopeinig und Raimund Löw
Samstag, 27.8.
Der Falter Auf allen Kanälen
Russlands Ukraine-Krieg – Mythen, Realitäten und Europas Wahrnehmung von Putin im Symposium der Salzburger Festspiele. Mit Historiker Karl Schlögel, Schriftstellerin Tanja Maljartschuk und Diplomat Emil Brix, Journalistin Susanne Scholl und Theatermacherin Marina Davydova. Moderation: Michael Kerbler
Sonntag, 28.8.
Die Russland-Debatte. Wie Putins Russland in einen neuen Faschismus treibt und warum Europa auf alles gefasst sein sollte. Mit Karl Schlögel, Tanja Maljartschuk, Emil Brix, Susanne Scholl, Marina Davydova, Michael Kerbler
4 FALTER 34/22 AN UND ÜBER UNS
Podcast & Falter-TV
Gerhard Zeiler, Stefan Lehne, Emil Brix, Susanne Scholl
FALTER
DER PODCAST MIT RAIMUND LÖW FOTOS: PRIVAT, APA/HELMUT FOHRINGER, IWM.AT, PARLAMENT.GV.AT, APA/KATHARINA GOSSOW
Katastrophen, Tipping-Points und ein Zentrum, das nicht hält

Immer wenn Hochwasserkatastrophen eintreten, ergreift mich zuerst Empathie. Wer selbst einmal so etwas erlebt hat, Schlamm schippte, dem unausweichlichen Steigen des Wassers ausgeliefert war, den Heroismus von Feuerwehr und Bundesheer dankbar annahm, die Hilfsbereitschaft von Nachbarn und Unbekannten freudig bestaunte, kann das verstehen.
Es ergreift mich aber auch Besorgnis. Die Klimakatastrophe wird der härteste Test für unsere gemeinsame Basis, dass es in wichtigen Dingen (was ist wahr, was ist falsch) allgemein akzeptierte Übereinkunft gibt. Die Klimaforschung kennt den Begriff des Tipping-Point, des Kipppunkts, nach dessen Erreichen Entwicklungen irreversibel sind. Den gibt es, fürchte ich, nicht nur beim Klima, den gibt es auch in der Entwicklung der Demokratie.
Ich fasse mir manchmal an die Nase und frage mich, warum ich so anhaltend auf die ÖVP einprügle. Die Antwort ist leicht und doch mehrschichtig. Erstens wurde ich als Schwarzer sozialisiert, in einem Bundesland und einer Schule (Bundesgymnasium Bregenz), wo es nichts erkennbar Rotes gab, das auf einen grünen Zweig kam (an anderen Farben existierte nur das Braunblau).



Zweitens gibt es dennoch gute Gründe, von einer bürgerlichen Mitte eine gewisse Festigkeit bei der Bewahrung des demokratischen Systems zu erwarten; hierzulande so etwas wie einen rheinischen Kapitalismus oder gar die ökosoziale Marktwirtschaft. Die Sozialdemokratie hat sich demgegenüber in eine Art kleinbürgerlichen Ableger, eine Variante der demokratischen Mitte entwickelt, weltanschaulich offener, wie man seit Kreisky meint, aber im Prinzip halt nur eine Schattierung liberaler.
Deswegen auch der Schock, wenn die halluzinierte Mitte sich als leer erweist (und das betrifft eben nicht nur die ÖVP). „The centre cannot hold“, heißt es im prophetischen und von der vorletzten Pandemie beeinflussten Gedicht „The Second Coming“(Das Jüngste Gericht) von William Butler Yeats. Dabei trifft in Österreich stets mit Verzögerung ein, was Konservative in den angelsächsischen Ländern vormachen. Betrachtet man diese gewesenen Vorbilder, wird der Schock nicht kleiner, eher größer.

Boris Johnson und Donald Trump sind nur Exponenten eines vielschichtigen großen Plans. Trump freut sich gerade, dass ihm die FBI-Durchsuchung seines Horror-Kitsch-Anwesens Mar-a-Lago nach geheimen, von ihm vermutlich widerrechtlich aus dem Weißen Haus exportierten Dokumenten einen Popularitätsschub verleiht. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Im hegemonialen demokratischen Rechtsstaat der Welt führt eine Ermittlung der Justizbehörden gegen einen Politiker nicht zu einem Vertrauensverlust für diesen, sondern zu einem Popularitätsgewinn.

Der Kern von Trumps Botschaft besteht darin, Skepsis gegen den Vorgang demokratischer Wahlen an sich zu säen. Wider jede Evidenz behauptet er, der Wahlsieg 2020 sei ihm von Joe Biden gestohlen worden. Die Demokraten wissen nicht genau, wie sie sich demgegenüber verhalten sollen; der Hinweis darauf, dass ihrem Kandidaten Al Gore die Wahl 2000 tatsächlich gestohlen wurde, indem der Oberste Ge-
„Übrigens, wir mögen den Falter.“




ARMIN THURNHER ist Mitbegründer, Herausgeber und Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter

Warum einem das Loch in der Mitte Sorgen machen muss, wenn man sich als demokratisch gesinnt versteht • Der Autor digital: Tägliche Seuchenkolumne: falter.at Twitter: @arminthurnher
richtshof die erneute Auszählung der Stimmen in Florida einfach stoppte, nützt gar nichts. Auch nicht der Verweis darauf, dass Gore in demokratischer Tradition den Sieg seines Kontrahenten George W. Bush dennoch anerkannte. Der neue Begriff in Trumps Anhängerschaft lautet „election denier“. Analog zum Corona-Leugner gibt es also nun den Wahlleugner. Das Mindestmaß an Vertrauen, das an Beisitzer, Zettelzähler und Wahlmaschinen delegiert wird, ist damit gekündigt. Wo aber gegenseitiges Misstrauen herrscht, kann keine Verständigung existieren, also auch kein Rechtsstaat. Dass die kommunikativen Verhältnisse derart erodierten und ein kompletter Relativismus nun alles infrage zu stellen scheint, ist paradoxerweise auch auf die Marktliberalisierung des Demokraten Bill Clinton und dessen Begünstigung der Tech-Konzerne zurückzuführen. Aber das Ergebnis, ein totaler Relativismus, liegt voll in der Absicht der neuen „Konservativen“, die längst zu rechten Revolutionären mutiert sind.
Sieht man diese Entwicklung nur durch den Filter der neoliberalen Gehirnwäsche, die hier immer wieder gern kritisiert wird, greift man deutlich zu kurz. Die neoliberale intellektuelle Offensive war mit ihrem sehr langen Atem und ihrem unerschöpflichen finanziellen Hintergrund doch einigermaßen rational. Sie wollte einen starken Staat erhalten, damit der den freien Markt garantiere. Ausrutscher ihres Erfinders Friedrich August Hayek, der den freien Markt zum Beispiel im Chile des Diktators Pinochet für weit wichtiger ansah als freie Wahlen, hielt man eben für Ausrutscher innerhalb eines doch im Ganzen demokratisch orientierten Gedankensystems, das eben für Unternehmerrechte und Kapitalistenfreiheit eintrat.
Das gilt nicht mehr. Karl-Heinz Otts interessantes neues Buch „Verfluchte Neuzeit. Eine Geschichte des reaktionären Denkens“ zeigt völlig unmissverständlich, worum es der neuen amerikanischen Rechten und ihren Ideologen geht: Es geht gegen die Welt des Rationalismus, gegen die grundlegenden Denker der Aufklärung, gegen Thomas Hobbes und René Descartes, ja selbst gegen John Locke, der doch von vielen sogenannten Liberalen als Galionsdenker kapitalistischer Erwerbsfreiheit verehrt wird.
Hobbes stellte staatspolitische Vernunft gegen die Autorität der Kirche. Er postulierte souveräne Bürger, die ihre Macht freiwillig an einen Souverän delegieren, der sie dann davor bewahrt, einander im Krieg aller gegen alle die Schädel einzuschlagen. Glauben sollte jeder können, was er will. Descartes’ Methode rationalen Denkens wiederum zog der Autorität der Kirche den Boden unter den Füßen weg.
Genau dorthin wollen die amerikanischen Rechten aber zurück: zu einer unbefragbaren Autorität, die Schluss macht mit dem allseitigen Anzweifeln und mit dem Infragestellen von allem und jedem. Peter Thiel, der Arbeitgeber unseres investorgewordenen Junior-Alt-Kanzlers, hat als ein Sprecher dieser knallharten Konservativen klar gesagt, worum es geht: im Zweifel für einen, der entscheidet, und gegen eine lahme, sich selbst anzweifelnde Demokratie. TippingPoints sind in Sicht. Ein Zentrum, das uns vor ihrem Passieren bewahren möchte, eher nicht.

THURNHER FALTER 34/22 5 1010 Wien, Spiegelgasse 5
Alexander Skrein
ET_8_Sep_24_Nov_SKREIN_SK101_Prinzesinnenring_FALTER_216x30ssp_RZ.indd 1 06.04.21 15:51
Faires Gold
René Descartes, philosophischer Vater der Rationalität
Donald Trump: Gott und absolute Macht statt Demokratie
Seinesgleichen geschieht Der Kommentar des Herausgebers
FOTOS: IRENA ROSC, FRANS HALS, 1648, AFP/STRINGER
Wladimir Putin gefällt das
Namhafte ÖVP-Politiker stellen die RusslandSanktionen infrage. Besser könnten sie das Geschäft des Kreml kaum erledigen
KOMMENTAR: MARTIN STAUDINGER

Strafmaßnahmen nicht zur Debatte stehen. Im Regierungsviertel hat man trotzdem Bammel davor, dass die FPÖ im Herbst zehntausende Menschen auf die Straße bringen könnte, die nicht einsehen, warum sie für einen Krieg in der Ukraine hohe Strom- und Gasrechnungen zahlen sollen –wenn ihnen von politischer Seite suggeriert wird, es gebe eine einfache Lösung für die Misere: Weg mit den Sanktionen.
verloren. Die Angreifer rücken stellenweise zwar vor, aber mit quälender Langsamkeit und unter hohen Verlusten. Ihnen fehlt vorerst die Kraft, ihre Kriegsziele zu erreichen.
Ob – und wenn ja: wann – sich der Kreml aufgrund von Sanktionen gezwungen sieht, in irgendeiner Weise einzulenken? Gute Frage. Fest steht nur, dass das garantiert nicht geschehen wird, wenn Europa jetzt schon einknickt.
Martin Staudinger leitet nach langjähriger Tätigkeit als Außenpolitikjournalist den Falter.Morgen

Sollte Wladimir Putin – was durchaus anzunehmen ist – in den vergangenen Tagen ansatzweise über die Nachrichtenlage in Österreich informiert worden sein, dürfte er sich bestätigt fühlen: Der Kreml-Chef ist ja davon überzeugt, dass die europäischen Gesellschaften zu schwach und zu verwöhnt sind, um der Bedrohung ihrer Wohlfühlzone auch nur mittelfristig standzuhalten.
Nur sechs Monate hat es seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine und des damit einhergehenden Wirtschaftskriegs gegen Europa gedauert, bis er quasi offiziell eine Bestätigung dafür bekam.
Am Freitag hat der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer, eines der schwereren politischen Gewichte der ÖVP, in aller Öffentlichkeit die RusslandSanktionen der EU infrage gestellt. Man müsse die „Treffsicherheit“ der Maßnahmen überprüfen, sie seien „nicht in Stein gemeißelt“, sagte er der Kleinen Zeitung. Wenig später schloss sich der Tiroler ÖVP-Landeshauptmann in spe, Anton Mattle, dieser Einschätzung an, zuletzt dann auch Wiens ÖVP-Landesparteichef Karl Mahrer.
Wie sehr diese Hoffnung verbreitet ist, zeigen aktuelle Umfragen, in denen fast 40 Prozent der Befragten die Maßnahmen gegen Russland lieber abschwächen oder ganz aufgeben würden.
Nachzudenken, ob die Strategie, der Aggression Russlands durch finanziellen Druck zu begegnen, greift und welche Kon-
Darüber, wie groß der Druck gegen die Sanktionen wird, entscheidet auch das eigene politische Verhalten
Putin ist aktuell im Vorteil. Er hat nicht nur ein repressives System errichtet, das keinen Widerspruch zulässt; er hat via Medienkontrolle auch eine alternative Wirklichkeit geschaffen, in der für Widerspruch gar kein Anlass besteht.
Regierungen in liberalen Demokratien haben glücklicherweise weder die Möglichkeit zum einen noch zum anderen, dafür aber folgerichtig das Problem, ihre Klientel bei Laune zu halten. Darin liegen Verantwortung und Chancen gleichermaßen.
Zum Thema
Wie gut wirken die Sanktionen gegen Russland? Ein Interview mit dem russischen Ökonomen Sergej Guriev zu dieser Frage lesen Sie auf Seite 17
Klar: WKO-Präsident Harald Mahrer hatte als Interessenvertreter der Wirtschaft bereits vorher Zweifel angemeldet, FPÖ-Chef Herbert Kickl als Rabiatoppositioneller detto. Aber Stelzer, Mattle und Karl Mahrer sind die ersten Spitzenpolitiker einer Regierungspartei, die aus dem allgemeinen Konsens ausscheren.
Das wiegt umso schwerer, als aus dem Kanzleramt zunächst ein Gemurmel kam, das ebenfalls als Sanktionsskepsis ausgelegt werden konnte. Erst am Montag Abend bekräftigte Kanzler Karl Nehammer, dass die
sequenzen sie hat, ist ein Gebot der politischen Verantwortung – und es ist nicht leicht. Wie sehr der Stopp von Technologietransfer, das Einfrieren von Vermögenswerten, der Rückzug westlicher Unternehmen die russische Wirtschaft treffen, lässt sich konkret nicht festmachen. Der Kreml liefert ja längst keine Basisdaten mehr, an denen sich das ablesen ließe.
Anzunehmen, dass die Sanktionen keine schmerzlichen Auswirkungen hätten, heißt aber bloß, auf die Propaganda des Kreml hineinzufallen, der naturgemäß alles unternimmt, um die Wirkung kleinzureden. Dass die EU für Russland als Handelspartner immer mehr wegfällt, lässt sich ebenso wenig wegleugnen wie kompensieren. Pipelines nach China und Indien baut man nicht in ein paar Monaten. Und wer den Frontverlauf in der Ukraine verfolgt, weiß: Putins Truppen haben dort ihr Momentum
Denn darüber, wie groß der gesellschaftliche Druck gegen die Sanktionen wird, entscheidet nicht zuletzt das politische Geschick. Man kann Führungskompetenz zeigen. Man kann um Verständnis dafür werben, dass Beeinträchtigungen des gewohnten Wohlbefindens zu erwarten sind, wenn es darum geht, einem Aggressor entgegenzutreten, der nicht nur ein unabhängiges Land in unserer Nachbarschaft bedroht, sondern auch die europäische Gemeinschaft, ihre Werte und Freiheiten. Und man kann demonstrieren, dass alles getan wird, um die bevorstehenden Härten für all jene zu lindern, die dazu selbst nicht in der Lage sind.
In Österreich hat es bislang gerade einmal zur Ankündigung gereicht, dass eh bald ein Modell zur Abfederung der hohen Stromkosten präsentiert wird. Stattdessen wird nun begonnen, einen großen Irrtum zu verbreiten, mit dem man sich selbst Druck macht (und auch gleich die EU-Gesamtstrategie unterläuft): dass alles gut wird, wenn man ein bisschen netter zu Putin ist.
Besser kann man das Geschäft des Kreml eigentlich nicht erledigen.
Rechtsnationalistische Bedrohung aus Italien
I n Italien, einem zentralen Mitgliedsstaat der EU und der Nato im Mittelmeer, droht eine Regierung unter rechtsextremer Führung. Die liberalen Wertvorstellungen, die das Nachkriegseuropa geprägt haben, wie die universellen Rechte und der Schutz von Minderheiten, sind in Gefahr. Europa soll in eine autoritäre und nationalistische Richtung gelenkt werden. Mit Italien, Ungarn und Polen droht ein mächtiger antiliberaler Block zu entstehen.
Wenn die derzeitigen Umfragen halten, werden die Fratelli d’Italia, die ihre politischen Wurzeln in der faschistischen Tradition haben, bei den Wahlen im September stärkste Kraft werden, ungefähr gleichauf mit dem sozialdemokratischen PD. Ihrem Wahlbündnis mit der rechtspopulistischen Lega Matteo Salvinis und der konservativen Forza Italia des 85-jährigen Silvio Berlusconi wird eine klare Mehrheit im Parlament prognostiziert, während das zersplitterte linke Bündnis selbst mit der Unterstützung der kleineren Zentrumsparteien in der Minderheit bliebe.
Dann würde Giorgia Meloni, die 45-jährige Leitfigur der Partei, den Anspruch auf die Führung der Regierung stellen. In einem heiklen Moment, in dem die Stabilität Europas durch den russischen Überfall auf die Ukraine, die Energiekrise und die Inflation erschüttert wird. Und fast genau
zum 100. Jahrestag des Marschs auf Rom, mit dem Mussolini im Oktober 1922 mithilfe bewaffneter Schlägertrupps die Macht eroberte und den Siegeszug des Faschismus eröffnete.
In Europa wird jetzt darüber diskutiert, wie stark das faschistische Erbe die Politik Melonis bestimmen würde. Die beruhigende Nachricht ist: Eine Wiederholung des Marschs auf Rom wird es nicht geben. Die in der demokratischen Verfassung von 1946 verankerten Kontrollen und Institutionen funktionieren noch, und die Enkel Mussolinis haben ein pragmatischeres Verhältnis zur Demokratie als ihre Vorfahren.
Die Nachfolgepartei der Faschisten wollte die demokratische Verfassung nie anerkennen. Giorgia Melonis Haltung ist schwer zu entziffern. In den 1990er-Jahren distanzierten sich die Erben Mussolinis von dessen Ideologie und schlossen sich Berlu-
6 FALTER 34/22 MEINUNG
Franz Kössler kommentiert an dieser Stelle das Weltgeschehen
Ausland Die Welt-Kolumne
FRANZ KÖSSLER
CATHRIN KAHLWEIT IN DER SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG VOM 19. AUGUST
Kommentar Kultur
Touri-Saga: Schriftsteller Felix Mitterers „Piefke“-Abgabe
DUSINI
Das Drehbuch könnte von Felix Mitterer stammen: Ein Tiroler Autor, bekannt auch als scharfer Kritiker des Fremdenverkehrs, kehrt in seine alpine Heimat zurück und wird dazu aufgefordert, die sogenannte Tourismusabgabe zu zahlen. Mit dem Geld trägt er dazu bei, dass noch mehr Skifahrer auf die Pisten und Mountainbiker auf die Gipfel strömen.

Mitterer ist der Drehbuchautor der 30 Jahre alten legendären TV-Serie „Piefke-Saga“, die die Auswüchse des Tourismus karikiert. Er ist nun selbst Protagonist einer Farce. Als Mitterer 2021 von Niederösterreich nach Schwaz übersiedelte, wurde er von den Behörden dazu aufgefordert, die Tourismusabgabe zu entrichten. Der empörte Autor weigert sich und will wieder weg: „Der Verfasser der ,Piefke-Saga‘ kann keine Tourismusabgabe zahlen.“ Mitterer geht’s nicht um den kleinen Betrag, sondern ums Prinzip.
Der Pflichtbeitrag wurde bereits 1927 eingeführt, um das Geschäft mit den Gästen anzukurbeln. Zahlen müssen ihn indirekt profitierende Betriebe und Selbstständige, zu denen Künstlerinnen und Künstler gehören. Neben der von den Gästen berappten Kurtaxe hilft die Abgabe den örtlichen Tourismusvereinen, Aufgaben zu erledigen, die auch den Einheimischen zugutekommen: etwa Loipen zu präparieren oder Wanderwege anzulegen.
Der Ablauf der Causa bleibt im Genre einer ländlichen Komödie. In der Serie rennt Ober-„Piefke“ KarlFriedrich Sattmann stets zum Bürgermeister, wenn ihm etwas nicht passt. Auch Mitterer sah sich nicht als einfacher Bürger und Steuerzahler, sondern suchte den direkten Kontakt zu Lan-
deshauptmann Günther Platter. Der wiederum verhielt sich wie ein Dorfkaiser und stellte eine gnädige „Tiroler Lösung“ in Aussicht.
In Österreich gibt es einen Kirchenbeitrag, den nur Katholiken und Katholikinnen zahlen müssen. Auch wenn der Tourismus in Tirol eine Art Ersatzreligion ist, sollte es möglich sein, aus der Glaubensgemeinschaft der Hoteliers und Skiliftbesitzer auszutreten. Für all jene selbstständig Denkenden, die die Sprengung von Bergspitzen zur Schaffung neuer Pis-
ten und die Einrichtung von Hubschrauberlandeplätzen für betuchte Gäste ablehnen, erscheint die Tourismusabgabe wie ein Hohn.
Die Kultur spielt eine wichtige Rolle bei der Propagierung eines anderen Tourismus. Hätten die zuständigen Politiker und Politikerinnen Mitterers „Piefke-Saga“ vor 30 Jahren ernst genommen, wäre uns die Dystopie Ischgl, nicht erst seit Corona das Symbol für rücksichtslose Raffgier, erspart geblieben.
So kann man nur der Haller Schriftstellerin Barbara Hundegger zustimmen, die – von der Öffentlichkeit unbemerkt – im Oktober 2021 im Rahmen einer Preisverleihung den Vorschlag machte, „dem Tourismus eine Kunstabgabe zu verordnen“.
sconi an, Meloni wurde Ministerin. 2012 aber gründete sie die Fratelli d’Italia und knüpfte wieder an die neofaschistische Vorgängerorganisation an. Deren Symbol, die aus dem Sarg Mussolinis lodernde Flamme, findet sich auch im aktuellen Parteisymbol wieder. Viele ihrer Anhänger zeigen noch immer den faschistischen Gruß. Abgeordnete fordern, den Feiertag zum Sieg über den Faschismus abzuschaffen. Die Partei arbeitet mit militanten rechtsextremen Organisationen zusammen. Der Historiker Aram Mattioli, ein führender Analytiker des Faschismus in Italien, kommt zu dem Schluss, dass ein klarer Bruch mit dem faschistischen Erbe bis heute aussteht.
Melonis Demokratieverständnis nur an ihrem Verhältnis zur Vergangenheit zu messen, greift zu kurz. Zur Beruhigung der EU hat sie eine Video-Erklärung verfasst, in der sie sich in drei Sprachen von Musso-
linis Abschaffung der Demokratie und den Rassengesetzen distanziert. Den Faschismus erklärt sie als historisch überholt. Am anstößigen Parteisymbol aber hält sie fest. Sie betont ihr grundsätzliches Bekenntnis zur EU, die sie bisher skeptisch sah, und zur Nato, trotz früherer Sympathien für Putin. Im konservativen britischen Spectator definiert sie sich als Rechtskonservative, ähnlich den britischen Tories oder Trump-Republikanern.
Was sie darunter konkret versteht, hat sie im Juni vor der rechtsextremen spanischen Vox dargelegt: Sie will den Kulturkampf in Europa anführen, gegen die Bedrohung der christlichen Wurzeln durch die säkulare Linke und den radikalen Islam. Die Entscheidung – sagt sie – müsse zwischen natürlicher Familie und LGBTQLobbys fallen, zwischen der Universalität des Kreuzes und der islamistischen Gewalt,
zwischen sicheren Grenzen und Massenimmigration. Die Nähe zu Orbáns illiberaler Demokratie und dem Nationalkonservatismus der polnischen PiS ist deutlich zu hören. Sie sind Melonis Partner in ihrer geplanten Umorientierung der EU.
Italien selbst soll in eine Präsidialrepublik umgewandelt werden. Der Staatspräsident, jetzt von einer parlamentarischen Versammlung gewählt, soll direkt vom Volk bestimmt werden. Das wird als direkte Demokratie angepriesen. In Italien wäre es ein Schritt zur Aushöhlung der parlamentarischen Mechanismen, die nach dem Faschismus zum Schutz gegen Autoritarismus in der Verfassung verankert wurden.
So mag Melonis Distanzierung vom historischen Faschismus beruhigend wirken. Ihr aktuelles Programm aber stellt eine akute Gefährdung der liberalen Werte Europas dar.

75 Parteien sind zu den Wahlen am 25. September zugelassen. Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia und vier weitere gehören zum Rechtsbündnis; Partito Democratico und acht weitere zum Linksbündnis; mehrere Kleinstparteien zur Mitte. Der amtierende Ministerpräsident Mario Draghi macht nicht weiter

MEINUNG FALTER 34/22 7
Parteien-Pluralismus
Von einer Zustimmung wie in Deutschland, wo die Ökopartei in Umfragen bundesweit gerade die 25-Prozent-Marke übersprungen hat, können die österreichischen Grünen nur träumen
Der Autor Matthias Dusini wuchs in einem Südtiroler Tourismuszentrum auf
Tex Rubinowitz Cartoon der Woche
Zitiert Die Welt der Weltblätter
MATTHIAS
Frauenpower dürfte Trump verhindern
PETER MICHAEL LINGENS

Noch hat Donald Trump nicht bekanntgegeben, ob er neuerlich für das Amt des Präsidenten kandidiert, aber ich bin sicher, dass er es tun wird: Nur so kann er die gegen ihn laufenden Verfahren als Hexenjagd diffamieren, und nur als Präsident kann er verhindern, für Jahre im Gefängnis zu landen. Denn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat er Steuern hinterzogen, stünde er bei funktionierender Justiz längst wegen der Anstiftung zum Sturm aufs Kapitol vor einem ordentlichen Gericht und hätte er jetzt den Diebstahl geheimer Akten zu verantworten. Trump droht lebenslanger Kerker – daher wird er alles tun, um wieder Präsident zu werden.
Für Europa wird von seinem Erfolg abhängen, ob es durch eine intakte Nato geschützt wird oder ob die USA in Trumps zweiter Amtszeit womöglich aus dem in seinen Augen „obsoleten“ Bündnis austreten, wie er das ernsthaft erwogen hat. Denn auch sein Verhältnis zu Wladimir Putin ist außergewöhnlich: Der russische Kriegsherr kann jederzeit beweisen, dass er Trumps Wahl 2016 massiv unterstützt hat und dass Trumps Imperium mit Geldern des KGB vor der Pleite bewahrt wurde.
Bundesstaat erhalten hatte – Bidens Investitionspaket für Klima und Soziales doch noch gebilligt hat. Dadurch scheint die Konjunktur der USA gesichert. Zwar wurde das Paket von geplanten 3,5 Billionen Dollar auf 1,85 Billionen abgespeckt, was den Klimawandel kaum wie erhofft eindämmen, wohl aber Jobs schaffen wird.
Gleichzeitig wird die Inflation den Amerikanern nicht mehr im Ausmaß der letzten Monate zusetzen. Nicht weil die USNotenbank die Zinsen soeben zum zweiten Mal drastisch um 0,75 Prozent erhöht hat
Die Chancen Donald Trumps, neuerlich zum Präsidenten der USA gewählt zu werden, sind im letzten Monat erheblich gesunken. Kämpferischen Frauen und der OPEC sei Dank
das pandemiebedingte Abreißen wichtiger Lieferketten – nie die „Geldschwemme“ der Notenbanken – waren und sind die zentralen Ursachen der Inflation. Nur dass sie in den USA, anders als in der EU, schon unter Trump auch durch große Einkommenszuwächse beflügelt wurde und daher in den USA noch höher ausfiel.
Der Autor war langjähriger Herausgeber und Chefredakteur des Profil und der Wirtschaftswoche, danach Mitglied der Chefredaktion des Standard. Er schreibt hier jede Woche eine Kolumne für den Falter. Siehe auch: www.lingens.online
lingens@falter.at
Impressum
Ob Trump wiedergewählt wird, ist daher die zweifellos wichtigste Entscheidung der Nachkriegszeit: Gelingt ihm die Wiederwahl, so hört der mächtigste Staat der Welt auf, eine rechtsstaatliche Demokratie zu sein, und das ist mit den Worten Simon Wiesenthals „die größte Katastrophe, die der freien Welt zustoßen kann“. Die schlechte Nachricht lautet: Dieser GAU ist in keiner Weise ausgeschlossen oder auch nur „höchst unwahrscheinlich“. Die gute Nachricht lautet: Im letzten Monat ist er um einiges unwahrscheinlicher geworden – die Chancen, dass ein Demokrat 2024 über Trump siegt, haben sich stark verbessert.
Am Rande, weil die erfolgreiche Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland die Erinnerung an das Fiasko Joe Bidens beim Afghanistan-Abzug langsam in den Hintergrund drängt. Vor allem aber, weil der Kongress im letzten Moment –nachdem ein widerstrebender demokratischer Senator spezielle Zusagen für seinen
– denn das wirkt erst mit Verzögerung –, sondern weil die OPEC die Ölförderung drastisch erhöht. Bekanntlich haben die Golfstaaten sie angesichts der Pandemie mit freudiger Zustimmung Putins, der bereits an die Finanzierung seines UkraineKrieges dachte, massiv gedrosselt, und die USA haben das angesichts der Probleme ihrer Fracking-Industrie, die Öl eher teuer fördert, geduldet.
Diese Duldung hat Biden beendet und den Golfstaaten wie in der Vergangenheit klargemacht, dass sie nur mit US-Waffenhilfe rechnen können, wenn Öl wieder billiger wird, indem sie mehr davon fördern. Das tun sie, und es hat den Treibstoffpreis als sichtbarstes Zeichen der Inflation bereits erheblich gesenkt und wird auch andere Preise sukzessive senken. Denn die nun beendete Verteuerung des Öls und daneben
Die in meinen Augen gewichtigste Steigerung haben die Chancen der Demokratischen Partei aber durch die Abstimmung erfahren, die im Bundesstaat Kansas darüber abgehalten wurde, ob es dort weiter beim gesicherten Recht auf Abtreibung bleibt: Gut 60 Prozent der Bevölkerung dieses höchst konservativen Bundesstaates votierten am 2. August dafür, den Abtreibungsschutz in der Landesverfassung zu belassen – nur 39 Prozent stimmten dagegen. Hätte die Mehrheit dagegen gestimmt, wäre es der republikanischen Regierung dank der seit Juni geänderten Rechtsprechung des Supreme Court möglich gewesen, das Abtreibungsrecht massiv zu verschärfen. Umfragen hatten dieses Ergebnis nicht entfernt erwarten lassen: Frauen wagen es in republikanischen Staaten zwar offenbar nicht, offen für das Recht auf Abtreibung einzutreten – doch in der Wahlzelle tun sie es sehr wohl.
Es ist zwar sehr schwer, das Ausmaß dieses Effekts abzuschätzen, wenn die Abstimmung statt des konkreten Rechts auf Schwangerschaftsabbruch eine allgemeine politische Entscheidung zum Gegenstand hat. Dennoch halte ich es, anders als vor dem Wahlgang in Kansas, nicht mehr für völlig ausgeschlossen, dass die Demokraten bei den Midterm-Wahlen am 8. November ihre schmale Mehrheit in Senat und Repräsentantenhaus doch behalten. Aber selbst wenn sie sie verlieren und Joe Biden damit für den Rest seiner Amtszeit innenpolitisch zur „lahmen Ente“ degradiert wird, wird der Schwangerschaftsabbruch doch ein emotionales Atout der Demokraten bei den Präsidentschaftswahlen bleiben. Zusammen mit all dem, was über den Sturm auf das Kapitol selbst zu Amerikanern durchgedrungen sein muss, die sich Augen und Ohren zuhalten, sollte „Frauenpower“ reichen, den Trump-GAU abzuwenden.
FALTER Zeitschrift für Kultur und Politik.
45. Jahrgang
Aboservice: Tel. +43-1-536 60-928
E-Mail: service@falter.at, www.falter.at/abo Adresse: 1011 Wien, Marc-Aurel-Straße 9, Tel. +43-1-536 60-0, Fax +43-1-536 60-912
HERAUSGEBER : Armin Thurnher
Medieninhaber : Falter Zeitschriften Gesellschaft m.b.H.
Chefredakteure: Florian Klenk, Armin Thurnher
Chefin vom Dienst: Isabella Grossmann, Petra Sturm
Redaktion: POLITIK: Nina Brnada, Nina Horaczek (Chefreporterin), Eva Konzett (Ltg.), Josef Redl (Wirtschaft)
MEDIEN: Barbara Tóth (Ltg.)
FEUILLETON: Matthias Dusini (Ltg.), Klaus Nüchtern, Michael Omasta, Stefanie Panzenböck (kar.), Lina Paulitsch, Nicole Scheyerer, Gerhard Stöger
STADTLEBEN Lukas Matzinger (Ltg.), Katharina Kropshofer
NATUR: Benedikt Narodoslawsky (Ltg.)
WOCHE: Lisa Kiss (Ltg.)
FALTER.morgen: Martin Staudinger (Ltg.), Soraya Pechtl
Ständige Mitarbeiter: POLITIK und MEDIEN: Isolde Charim, Melisa Erkurt, Anna Goldenberg, Franz Kössler, Kurt Langbein, Peter Michael Lingens, Raimund Löw, Markus Marterbauer, Tessa Szyszkowitz
FEUILLETON: Kirstin Breitenfellner, Miriam Damev, Sebastian Fasthuber, Michael Pekler, Martin Pesl, Sara Schausberger
STADTLEBEN: Andrea Maria Dusl, Florian Holzer, Peter Iwaniewicz, Nina Kaltenbrunner, Doris Knecht, Julia Kospach, Heidi List, Werner Meisinger, Maik Novotny, Hermes Phettberg, Irena Rosc, Katharina Seiser, Johann Skocek NATUR: Gerlinde Pölsler
WOCHE: Sara Schausberger, Sabina Zeithammer
Redaktionsassistenz: Tatjana Ladstätter
Fotografen: Heribert Corn, Katharina Gossow, Christopher Mavrič
Illustratoren: Georg Feierfeil, PM Hoffmann, Oliver Hofmann, Daniel Jokesch, Tex Rubinowitz, Stefanie Sargnagel, Jochen Schievink, Bianca Tschaikner
Produktion, Grafik, Korrektur: Falter Verlagsgesellschaft m.b.H.
Art Direction: Dirk Merbach (Creative Director), Raphael Moser Grafik und Produktion: Raphael Moser (Leitung), Barbara Blaha, Marion Großschädl, Reini Hackl (kar.), Andreas Rosenthal, Nadine Weiner
KORREKTUR: Regina Danek, Theodora Danek, Wolfgang Fasching, Helmut Gutbrunner, Daniel Jokesch, Wieland Neuhauser, Patrick Sabbagh, Rainer Sigl
GESCHÄFTS FÜHRUNG : Siegmar Schlager
Finanz: Petra Waleta Marketing: Barbara Prem
Anzeigenleitung: Sigrid Johler
Abwicklung: Franz Kraßnitzer, Oliver Pissnigg Abonnement: Birgit Bachinger Online: Florian Jungnikl-Gossy (CPO), Datentechnik: Gerhard Hegedüs
Vertrieb: Presse Großvertrieb Austria Trunk GmbH, 5081 Anif Druck: Passauer Neue Presse Druck GmbH, 94036 Passau
Erscheinungsort: Wien. P.b.b., Verlagspostamt 1011 Wien
E-Mail: wienzeit@falter.at Programm-E-Mail: kiss@falter.at Homepage: www.falter.at
Der Falter erscheint jeden Mittwoch. Veranstaltungshinweise erfolgen kostenlos und ohne Gewähr. Gültig: Anzeigenpreisliste 2021. DVR-Nr. 047 69 86. Alle Rechte, auch die der Übernahme von Beiträgen nach § 44 Abs. 1 und 2 Urheberrechtsgesetz, vorbehalten.
Die Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz ist unter www.falter.at/offenlegung/falter ständig abrufbar.
8 FALTER 34/22 MEINUNG
Peter Michael Lingens kommentiert hier jede Woche vorrangig das wirtschaftspolitische Geschehen
Außenblick
Lingens
Salman Rushdie und die Meinungsfreiheit
ISOLDE CHARIM
Isolde Charim kommentiert an dieser Stelle wöchentlich politische Zustände


Salman Rushdie, indisch-britischer Autor, wurde für seinen Roman „Die satanischen Verse“ vom iranischen Revolutionsführer und Ajatollah Ruhollah Chomeini mit einer Fatwa belegt. Er wurde also von einer islamischen Autorität zum Feind erklärt und als Opfer markiert. Das war 1989. Wer das nicht wusste oder längst vergessen hatte, wurde durch das schaurige Attentat auf den Autor am 12. August daran erinnert.
Seitdem wird Rushdie – gewissermaßen spiegelverkehrt – in den westlichen Medien als Held und Opfer der Meinungsfreiheit gewürdigt. Man möchte ihm weder das eine noch das andere absprechen: Weder das Heldenmütige noch das Opfertum sind infrage zu stellen.
Aber ob die Sache mit der Meinungsfreiheit so eindeutig ist, lässt sich hinterfragen.
Nicht zuletzt deshalb, weil Rushdie selbst in seiner Autobiografie im Jahre 2012 angemerkt hat: Seine eigene Verteidigung der Redefreiheit, für die er all die Jahre gekämpft habe, klinge in seinen Ohren mittlerweile abgestanden. Er beginne zu erkennen, dass das Prinzip, das er verkörpert, im Verfall begriffen sei.
Genau das zwingt dazu, Äußerungen zu reglementieren. Durch sogenannte „HassGesetze“ etwa. So wird der Missbrauch im Namen der Meinungsfreiheit getätigt – während der Schutz als Einschränkung der Äußerungen erscheint. Was für eine Verkehrung!
Man muss heute immer wieder feststellen: Die alten demokratischen Prinzipien sind vor ihrer Pervertierung nicht gefeit. Das wird gerade dann deutlich, wenn sie –wie jetzt nach dem Attentat – wie ein Fe-
Die alten demokratischen Prinzipien sind vor ihrer Pervertierung nicht gefeit.
Das wurde gerade nach dem Attentat deutlich
nern auch nicht, das Wort zu tilgen – etwa „störende“ Schriften zu verbieten. Es muss auch der Sprecher, der Einzelne, der „Störende“ getroffen werden.
Es ist gerade der Kern dieses Rechts, der heute allgemein nur allzu häufig missverstanden wird: als uneingeschränktes Recht, als unbegrenzter Anspruch auf seine Einzelheit.
Letztlich begeht auch der Attentäter in gewisser Weise eine solche Anmaßung –diese aber in völlig pervertierter, in blutiger Form: ein Handeln als eigenmächtiger Einzelner. Gegen die ganze Gesellschaft, in der er lebt und aufgewachsen ist.
Klar – anders als ein Amokläufer folgt er dabei einem Ruf, der von anderswoher ergeht. Und die Fatwa ist ein sehr eindeutiger Ruf: „Ich informiere alle eifrigen Muslime der Welt, dass der Autor des Buches mit dem Titel ,Die satanischen Verse‘ (...) und alle an seiner Veröffentlichung Beteiligten, die von seinem Inhalt wussten, zum Tode verurteilt sind. Ich rufe alle eifrigen Muslime auf, sie schnell hinzurichten.“
Die Autorin ist Philosophin, Publizistin und wissenschaftliche Kuratorin
charim@falter.at
Erkurt Nachhilfe
Die Meinungsfreiheit ist schal geworden. Nicht zuletzt seit sie zum Schlachtruf von Hetzern aller Art geworden ist. Vom einstigen Aufbegehren gegen das autoritäre Herrscherwort bleibt vor allem eines: die Widerstandspose.
Jede Hetze wird heute im Brustton der Meinungsfreiheit betrieben. Jede Hasstirade missversteht sich als freies Wort und bricht sich solcherart veredelt Bahn.
tisch beschworen werden. In unhinterfragter Nostalgie. Als ob sie ungebrochen noch ihre alte Bedeutung, ihre ehemalige Funktion, ihren früheren Stellenwert hätten. Als ob sie nicht neu zu definieren wären.
Zugleich aber macht das Attentat noch einmal deutlich, was eigentlich den Kern der Meinungsfreiheit ausmacht. Diese ist als Recht auf freie Meinung und deren Äußerung letztlich ein Recht auf seine eigene Einzelheit. Deshalb reicht es den Geg-
Aber zugleich ist dies 33 Jahre her. Damals war der heutige Attentäter, 24 Jahre alt, noch nicht einmal geboren. Und es gab keine aktuelle äußere Reaktivierung. Insofern war die „Ermächtigung“ des jungen Mannes zur Tat noch fiktiver. Sie war gewissermaßen eigenständig.
Er wollte sich dieser Gesellschaft entziehen – und reproduzierte dabei deren zentrale Kategorie in entstellter Form: den eigenmächtigen Einzelnen. Man kann es nicht anders nennen: Es ist dies eine völlige Pervertierung des bürgerlichen Subjekts.
Frauenhass auf Social Media ist ein Symptom, keine Ursache
MELISA ERKURT
Melisa Erkurt kommentiert hier wöchentlich bildungspolitische Themen, aber nicht nur
Die Autorin ist Publizistin („Generation Haram“, 2020, Zsolnay) und Journalistin bei „Die Chefredaktion“, einem Medium für die junge Zielgruppe auf Instagram
erkurt@falter.at
Andrew Tate ist quasi der meistgesuchte Mann der Welt. Sein Name wurde im Juli öfter gegoogelt als der von Donald Trump oder Kim Kardashian. Der ehemalige Kickboxer ist im Netz für seine rassistischen, homofeindlichen und vor allem frauenverachtenden Aussagen bekannt. Er sagt in Videos, dass er Sex mit 18-Jährigen bevorzuge, weil sie weniger Erfahrung hätten, und dass Frauen an den Herd gehörten und Eigentum ihres Mannes seien, und erntet dafür Millionen Klicks und zustimmende Kommentare von mehrheitlich jungen Männern. Mit seinem Online-Programm „Hustler’s University“, laut Kritikerinnen* eine Art Pyramidensystem, verspricht er seinen Followern Erfolg und schnelles Geld.
Der US-Amerikaner lebt mittlerweile in Rumänien, weil die Vergewaltigungsgesetze dort laut Tate nicht so streng seien. Unterdessen laufen Ermittlungen wegen Menschenhandels und Vergewaltigung gegen ihn.
In den letzten Wochen wurde immer wieder Kritik an den sozialen Plattformen formuliert, die nichts gegen seine Inhalte, die eindeutig gegen die Community-Richtlinien verstoßen, unternehmen. Allein die Kritik des Influencers Matt Bernstein wurde über eine Million Mal gelikt. Vergangene Woche sperrten Facebook, Instagram und Tiktok Andrew Tate schließlich.
Das kommt viel zu spät und ist bei weitem nicht genug. In der Suchfunktion ist sein Name noch immer auffindbar, man bekommt zig seiner Videos auf zahlreichen Fan-Accounts angezeigt. Die sozialen Netzwerke schaffen es zwar immer wieder, Bilder, auf denen bloß Nippel von Frauen zu sehen sind, oder Posts, in denen über Abtreibungspillen informiert wird, zu sperren, aber Tates wirklich gefährliche Inhalte können weiterhin verbreitet werden. Sie werden 13-jährigen Buben öfter angezeigt als mir. Es scheint fast so, als nähmen die Plattformen das alles in Kauf, bloß damit wir mehr Zeit auf ihnen verbringen. Denn die Konkurrenz ist groß: Snapchat feiert bei Gen Z
ein Revival, und mit Bereal sorgt gerade ein neues soziales Netzwerk für einen Hype. Natürlich ist das Ganze viel mehr als ein Social-Media-Phänomen. Es sind nicht nur die zustimmenden Kommentare junger Männer zu Tates Aussagen, die Sorgen machen. Lehrerinnen berichten von Schülern, die sich nichts von ihnen sagen lassen, weil sie Frauen seien, und sich dabei auf Tate berufen. Kritik an ihm wird als „Männerhass“ abgetan, es wird mit „Meinungsfreiheit“ argumentiert. Er helfe, das Bild des Mannes, der die Welt verändern könne, zurückzuholen. Die Sehnsucht nach dem starken Mann macht auch vor der scheinbar aufgeklärten Generation Z nicht halt. Wie Influencer Bernstein richtig schreibt: Tate ist nur ein Symptom, nicht die Ursache. Junge Männer lernen noch immer nicht ausreichend, mit ihren Emotionen umzugehen – das kann nicht nur für sie selbst, sondern auch für Frauen und andere marginalisierte Gruppen gefährlich werden.
*Männer sind in dieser Kolumne immer mitgemeint
MEINUNG FALTER 34/22 9
Charim Einwurf
HERO

HÄLT DEN LADEN AM LAUFEN: OHNE FREIWILLIGE FEUERWEHR WÄRE DAS LAND EIN
 EINZIGES KATASTROPHENGEBIET
EINZIGES KATASTROPHENGEBIET
Das Vertrauen in die Demokratie er lischt langsam, die Zufrieden heit mit der Politik viel schneller, die Unparteilichkeit vieler staatlicher Institutionen steht im Zweifel.
Aber eine Organisation gibt es im Land, auf die sich alle einigen können, deren gut 250.000 Aktive (96 Prozent Männer) den Laden am Laufen halten.
Wenn Sie Dystopien reizen, brau chen Sie sich nur Österreich ohne frei willige Feuerwehren vorzustellen. Jeden Tag würden Fabriken bis zum Grund abbrennen, Autos auf dem Dach liegen bleiben, Haustiere würden nicht geborgen und Rauchgas würde nicht gestoppt, keiner würde Keller auspumpen und um-
Seine
gestürzte Bäume entfernen. Kulissen eines Katastrophenfilms. Nur in sechs Landeshauptstädten gibt es in Österreich Berufsfeuerwehren, überall sonst „retten, bergen, löschen und schützen“ Ehrenamtliche. Als also vergangene Woche in fast allen Bundesländern Flüsse überliefen und Stürme tosten, haben vor allem die gut 4500 freiwilligen Feuerwehren in ungezählten Einsatzstunden das Schlimmste verhindert.
Das alles ohne Lohn und noch immer ohne gesetzliche Dienstfreistellung für Einsätze. Danke.
Texte lesen sich wie vom Algorithmus einer
DOLM POLITIK
WORÜBER ÖSTERREICH…

…REDET
GENERALSTABSCHEF STRIEDINGER

Was gegen Rudolf Striedinger als Generalstabschef des Bundesheers sprach: 2020 wollte er ohne Wissen und im Widerspruch zu seiner Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) das Heer weniger schießen und mehr Schnee schaufeln lassen. Als Co-Chef der Gecko-Kommission zeichneten ihn penetrantes Flecktarn-Tragen und wunderliche Statements aus (Impfung als „strategische Waffe“). Außerdem ist ein Freund Striedingers ein Ex-Neonazi. Was für Rudolf Striedinger als Generalstabschef sprach: Er ist ÖAAB- und damit ÖVP-Mitglied. Also Glückwunsch, Rudolf Striedinger, zum höchsten Job im Bundesheer.
…STAUNT
ASYLZAHLEN
…REDEN SOLLTE
EINWANDERUNGSABSURDITÄTEN
Kann es sein, dass jemandem, der 35 Jahre in Wien lebt, mit einer Österreicherin verheiratet ist, eine respektable akademische Karriere absolviert und sich nie etwas hat zuschulden kommen lassen, die Staatsbürgerschaft verweigert wird? Ja. Und zwar, weil er in den vergangenen Jahren als Wissenschaftler zu oft im Ausland war. Der Fall Selim Aslan macht nicht nur auf ein veraltetes Staatsbürgerschaftsgesetz aufmerksam – sondern auch wieder einmal auf den unterirdischen Umgang der Einwanderungsbehörde MA 35 mit Antragstellern. Da wie dort besteht dringender Änderungsbedarf.
10 FALTER 34/22
Telegram-Gruppe
Verschwörungstheoretikern
Tassilo Wallentin – Anwalt Angstlust, Seite 16 FOTOS: APA/FREIWILLIGE FEUERWEHR
APA/FLORIAN
APA/AFP/MANAN
41.909 Menschen haben von Jahresbeginn bis Ende Juli laut Innenministerium in Österreich um Asyl angesucht. Das sind mehr als im Jahr der Flüchtlingskrise 2015. Damals waren es 37.000. Der Anstieg ist nicht auf Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zurückzuführen, die bis mindestens März 2023 ohnedies ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht haben. Die meisten Asylanträge (9407) stammen von Migranten aus Afghanistan. Einen ungewöhnlichen Höhepunkt gab es im Juli: Da suchten nicht weniger als 2113 Menschen aus Indien um Asyl in Österreich an. 250.000 Aktive
von
ausgespuckt.
KUCHL,
WIESER,
VATSYAYANA, PRIVAT
in 4500 Feuerwehren sind bei Unwettern und Unfällen einfach da
Vielleicht muss man diese an Sonderbarkeiten reiche Geschichte mit einer nüchternen Feststellung beginnen: Die handelnden Personen sind weg. Weder der ehemalige Geschäftsführer Bernhard Perner noch der ehemalige Aufsichtsratschef Michael Mendel arbeiten noch offiziell für die Cofag – also jene Stelle, die das österreichische Finanzministerium im Frühjahr 2020 aufsetzte, um bis dato 17 Milliarden Euro an Corona-Förderungen für die Unternehmen abzuwickeln.
Vielleicht hatten sie einfach nichts mehr zu tun. Vielleicht gab es für sie nichts mehr zu holen. Vielleicht aber wussten sie, dass die Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes, wie das Konstrukt mit vollem Namen hieß, bald in der Kritik versinken würde.
Bernhard Perner quittierte den Dienst am 30. Juni 2022. Michael Mendel schied am selben Tag aus dem Aufsichtsrat aus.
Die Frage nach ihrem Wirken, ihrer Rolle und den Folgen bleibt.
Am 9. August 2022 hat der Falter einen Rohbericht des Rechnungshofs veröffentlicht, der die Vorgänge rund um die Cofag stark bemängelte. Die Förderungen waren demnach nicht treffsicher, die Kontrollen zu lasch, es gab keinen Lernprozess und keine wissenschaftliche Evaluierung, keine parlamentarischen Rechte, dafür hohe Kosten für externe Berater, für Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer.
Wer hat sich das alles eigentlich ausgedacht?
Den Zeitdruck, die Dringlichkeit und keine Alternativen, diese Argumente haben Perner und Ex-Finanzminister Gernot Blümel stets vorgebracht, um die Entstehungsgeschichte der Cofag mitsamt den vielen Beratern zu rechtfertigen.
Nur: Das Duo Perner/Mendel hat es an anderer Stelle, bei der Abbag, der Bankenverwertungsgesellschaft des Bundes, auch nicht viel anders gemacht. Ohne Coronavirus im Nacken.
Deshalb beginnt diese Geschichte nicht im Frühjahr 2020, als das Coronavirus über Österreich hereinbricht. Sondern vier Jahre früher, 2016.
Bernhard Perner und Michael Mendel also. Der eine, Perner, ein langgedienter Kabinettsmitarbeiter mehrerer ÖVP-Finanzminister, der unter Hans Jörg Schelling sichtbar und unter dem damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, mächtig wurde.
Der andere, Mendel, ein deutscher Banker, einst Vorstand in der Bank Austria, später Mastermind in der Finanzkrise. Vor allem dort, wo die Finanzkrise nichts mehr übrig gelassen hatte: Mendel war federführend dabei, als man die notleidenden Volksbanken abwickelte, und in der Hülle, die die
Zwei und ihr Männer Baby
Bernhard Perner und Michael Mendel hatten bei der Cofag das Sagen. Sie taten, was sie bei der Cofag-Mutter Abbag gelernt hatten, üppige Beratergagen, hohe Gehälter und Ignoranz gegenüber der öffentlichen Verwaltung inklusive. Teil III der Falter-Berichterstattung zur Abwicklung der Corona-Fördermilliarden

Die Cofag-Trilogie
Am 9. August 2022 veröffentlichte der Falter einen Rohbericht des Rechnungshofs. In der zweiten Folge ging es um die Milliardenförderungen. In dieser Ausgabe lesen Sie über die Menschen hinter der Cofag

Kärntner Hypo Alpe Adria hinterließ: der Heta. Dort wirkte er als Aufsichtsratschef.
Der damalige Finanzminister Hans Jörg Schelling hatte Mendel geholt.
Man muss an dieser Stelle die Institutionen ordnen. 2009 hatte die Republik Österreich die Kärntner Bank Hypo Alpe Adria verstaatlichen müssen. Die Bank stand vor der Zahlungsunfähigkeit, ihre Pleite hätte das Land Kärnten mitgerissen. 2014 zerschlug die Republik die Bank und führte deren notleidende Kreditpakete in die Heta Asset Resolution AG über, die Heta.
Sie war fortan dafür verantwortlich, aus dem Ramsch noch herauszuholen, was es herauszuholen gab. Schließlich hatte die Republik der Hypo Alpe Adria neun Milliarden Euro an Steuergeld zugeschossen. Als organisatorische Abwicklungsstelle gründete das Finanzministerium 2014 eben auch die Abbag als „Abbaubeteiligungsgesellschaft des Bundes“.
Zum Geschäftsführer wurde Michael Mendel ernannt. Er blieb nur 20 Monate in dieser Funktion. Weil er gleichzeitig auch Aufsichtsratschef der Heta war, orte-
te die Finanzmarktaufsicht einen Interessenkonflikt. Mendel musste sich zwischen den beiden Posten entscheiden und wählte die Heta.
Hier könnte die Geschichte enden, hätte der Vertrag, der dieses Ende besiegelte, nicht eine zumindest sonderbare Fußnote enthalten. Darin wurde Mendel das Recht eines nachträglichen Bonus eingeräumt, sollte die Heta besonders viel Geld aus den notleidenden Assets herausholen, also eine hohe sogenannte Recovery-Quote aufweisen.
Erfolgsabhängige Zusatzzahlungen sind nichts Außergewöhnliches. Sie werden in der Regel aber bei Beginn eines Vertrags mit festgesetzten Zielen vereinbart. Im Falle Mendels erfolgte dies am Ende der Tätigkeit. Sein ursprünglicher Vertrag hatte nur eine schwammige Bereitschaft zum Bonus erwähnt. Das hat die Opposition im Frühjahr 2022 stark kritisiert.
2016 aber musste Mendel erst einmal seine Sachen ordnen. Einvernehmlich löste er das Dienstverhältnis mit der Abbag
POLITIK FALTER 34/22 11
BERICHT: EVA KONZETT Fortsetzung nächste Seite
auf, ließ sich den Passus mit dem Bonus unterschreiben. Im Vertrag hieß es damals, dass die Höhe eines derartigen Bonus „ausschließlich am Umsetzungsgrad des Abwicklungsauftrags der Heta zu orientieren sei, wobei eine allfällige Outperformance entsprechend zu berücksichtigen wäre“.
Was damals alle, und besonders Mendel als Aufsichtsratschef der Heta, längst wussten: Eine „Outperformance“ würde nicht schwierig werden. Denn aus den notleidenden Krediten der Heta von 2009 waren längst wieder gefällige Anlageobjekte geworden.
2016 war das, was Ökonomen und Banker eine „Hochboomphase“ nennen. Die Zentralbanken hatten die Leitzinsen auf null gestellt, frisches Geld flutete die Märkte auf der Suche nach Profit. Die „Assets“ der Heta, zum Beispiel Liegenschaften und Hotels in Südosteuropa, gewannen an Wert und fanden Käufer: „Damals ging alles weg“, erinnert sich ein hochrangiger Banker. Also ein Selbstläufer?

Nein, sagt zumindest Bernhard Perner. In einem ausführlichen Telefongespräch mit dem Falter legt er seine Sicht der Dinge dar. So habe Mendel den Bonus dafür erhalten, mit zwei großen Gläubigergruppen Vergleiche verhandelt zu haben. „Wir haben 16 Milliarden an Klagsrisiken und elf Milliarden Euro an Landeshaftungen wegbekommen.“ Ansonsten hätte die Insolvenz der Hypo Alpe Adria und des Landes Kärnten gedroht. „Und die Heta hätte gar nicht damit beginnen können, die Assets zu verwerten“, sagt Perner. Niedrigzinsphase hin oder her.
Das Projekt trug den Namen Pignus, lateinisch für Geisel.
Fest steht: Der Bonus wurde erst neun Monate nach Ausscheiden Mendels vertraglich aufgesetzt. Die Abbag hatte die Wirtschaftsprüfer von KMPG beauftragt, ein Schema für mögliche Bonuszahlungen aufzusetzen. Die Wirtschaftsprüfer entschieden, dass eine Recovery-Quote von 63,8 Prozent der Maßstab sei. Alles darüber sei als Erfolg zu bewerten und mit gestaffelten Sonderzahlungen verbunden. 500.000 Euro, wenn die Recovery-Rate die 63,8 Prozent übersteigt. 1,5 Millionen Euro, wenn sie über 78 Prozent klettert.
Nur wenige Wochen später gab die FMA, die einst von einer Verwertung in Höhe von 46 Prozent ausgegangen war, die neue, nun offiziell erwartbare Recovery-Rate der Heta mit offiziellen 64 Prozent an. Ein Bonus war Mendel damit sicher.
2020, als die Heta eine Verwertungsquote von mehr als 78 Prozent erreichte, bekam er 1,5 Millionen Euro ausbezahlt. Sein Abbag-Jahresgehalt hatte 100.000 Euro betragen. Sein Kompagnon Perner sieht darin jedenfalls nichts Ungewöhnliches: „Wenn man Topleute haben will, dann muss man sie marktgerecht bezahlen. Ein Vorstand einer großen österreichischen Bank bekommt mehrere Millionen Euro im Jahr.“
Das Finanzministerium als 100-prozentiger Eigentümer der Abbag wusste von der Bonusvereinbarung zunächst aber vor allem: nichts. Das belegen E-Mails, die dem Falter vorliegen.

Abteilungsleiterin im Finanzministerium, am 22. Dezember 2016: „Mit Herrn Mendel wurde bei seinem Ausscheiden als GF der Abbag offenbar eine Auflösungsvereinbarung geschlossen, die von Nolz (Aufsichtsratschef, Anm.) unterschrieben wurde. Waren wir hier involviert?” Zuständiger
DAS NETZWERK HINTER DER COFAG
Bei der Cofag treffen einander Altbekannte wieder. So rekrutierte das Finanzministerium den Geschäftsführer Perner aus der Cofag-Mutter Abbag. An seine Seite stellte man mit Michael Mendel einen Mann, der schon etliche Posten in der Bankenabwicklung inne gehabt hatte (und außerdem als zweiten Geschäftsführer Marc Schimpel von den Grünen). In den CofagAufsichtsrat hievte das Ministerium Personen aus dem Heta-Umfeld

Michael Mendel – die graue Eminenz
Der heute 65-jährige deutsche Banker kam über einen Vorstandsposten bei der Bank Austria nach Österreich. Er hielt führende Positionen bei der Immigon, der Abbaugesellschaft der Volksbanken, und bei der Heta. Für seinen 1,5-MillionenEuro-Bonus in der Abbag musste er heftige Kritik einstecken. Im Juli schied er als Aufsichtsratschef der Cofag aus
Bernhard Perner – der Macher Wegbegleiter nennen Perner blitzgescheit. Im Finanzministerium machte er sich als Bankenexperte einen Namen, die von ihm erarbeitete Reform der Bankenaufsicht überlebte den Ibiza-Skandal nicht. Die Grünen als neue Koalitionspartner der Türkisen ab 2020 wehrten sich. Er gilt als Vertrauter von Thomas Schmid. Die Cofag-Geschäftsführung legte er zurück und amtiert nur noch bei der Abbag

Die externen Berater Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer: Externe Berater haben an der Cofag Millionen verdient. Kritiker sehen in der Auslagerung an die Privatwirtschaft mehrere Probleme, darunter einen Know-how-Verlust und drohende Abhängigkeiten. Außerdem wird damit die Beamtenschaft desavouiert und die Verwaltung geschwächt

Mitarbeiter, zwei Minuten später: „Nein, ich höre davon zum ersten Mal.“
Der damals zuständige Finanzminister Hans Jörg Schelling konnte sich erst fünf Jahre später, im Februar 2022, daran erinnern, eine solche Bonuszahlung mündlich in Auftrag gegeben zu haben. Das hielt er in einer Erklärung fest. Ausgerechnet nachdem der Rechnungshof die hohe Bonuszah-
lung an Mendel öffentlich gemacht hatte. Die Abbag wusste sich zu helfen. Sie legte das Gutachten einer Universitätsprofessorin vor, die die Vorgänge 2016 und 2017 als rechtskonform deckte, aber ad hoc erstellt war. Der zuständige Aufsichtsrat der Abbag hatte sich einen Freibrief geholt.
Michael Mendel war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.
100 %
100 %
FOTOS: APA/HANS KLAUS TECHT; PHILIPP LIPIARSKI/WWW.GOODLIFECR 12 FALTER 34/22
11
Fortsetzung von Seite
Hans Jörg Schelling – der Einfädler Es war der damalige Finanzminister, der Michael Mendel Ende 2014 als Aufsichtsratschef zur Heta holte und zum Chefabwickler machte. Er kannte Mendel noch aus seiner Zeit bei der Volksbanken AG. In seine Zeit als Finanzminister fällt die Großabwicklung der Kärntner Hypo Alpe Adria Bank
Gernot Blümel – der Überforderte Als die Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 über Österreich hereinbrach, herrschte Chaos im Finanzministerium. Warum Minister Blümel die Abwicklung von milliardenschweren Corona-Förderungen ausgerechnet an die fachfremde Abbag auslagerte, hat er nie dargelegt. Er hat die Politik im Dezember 2021 verlassen


nahe, dass Perner die Ausschreibung für den Vorstandsposten auf Schmid hingeschrieben haben könnte. „Im 2. Absatz: international eher streichen? […] verhandlungssicheres Englisch auf jeden Fall“, diese Nachricht schickte er 2018 in einen Gruppenchat mit Schmid und dessen Mitarbeiterin. Später wird sich Schmid vergewissern, dass alle „Tipps von Bernhard“ in den Text eingearbeitet worden sind.
gewesen, also jene Summen, die der Staat aus seinen Unternehmen bekommt.
Einen hohen Betrag habe das aber nicht ausgemacht: „Denn nach wenigen Monaten war ich dann ja bei der Cofag.“ Das stimmt. Perner wechselte alsbald wiederum die Position. So schnell, dass sich offenbar eine saubere, zwischen Abbag und Öbag aufgeteilte Entlohnung nicht mehr ausging. So hätte Perner eigentlich sein Geschäftsführersalär bei der Abbag in Höhe von 280.000 Euro um 80.000 Euro reduzieren und dafür 150.000 Euro von der Öbag erhalten sollen.
Doch dazu kam es nicht mehr, wie der Rechnungshof kritisch anmerkte. Perner bezog weiterhin das volle Abbag-Gehalt. „Die Aufteilung war nicht trivial. Ich war bei der Abbag Geschäftsführer und bei der Öbag Dienstnehmer. Das geht mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten einher. Ich selbst habe den Vorschlag mit der Reduktion um 80.000 Euro gemacht“, sagt Perner.
Der Rechnungshof empfiehlt trotzdem, eine Nachforderung zu prüfen.
Die Bezüge sind das eine. Die Sinnhaftigkeit der Doppeltätigkeit in Abbag und Öbag das andere. Im Ibiza-U-Ausschuss im März 2021 hatte die Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper Perner darauf angesprochen. Seine Antwort: „Know-how-Transfer, kosteneffizienter und auch die langfristigere Perspektive für, sage ich einmal, Schlüsselpersonen. Da geht es ja nicht nur um mich, sondern auch um andere wertvolle Mitarbeiter, die man so halten konnte.“
Damit meinte er auch sich selbst. Im Frühjahr 2020 bekam Perner seine Schlüsselrolle: Finanzminister Gernot Blümel machte ihn zum Geschäftsführer der Cofag. Er habe stets eng in Abstimmung mit dem Finanzministerium gearbeitet, erklärt Perner heute. Und was sagt er darüber hinaus?

Hohe Boni, Intransparenz, externe Berater: Man könnte diese Vorgänge als kurioses Schlusskapitel einer letztlich erfolgreichen Bankenrettung abtun. Wären da nicht die Parallelen zur Cofag, jenem Vehikel, das bis dato 17 Milliarden Euro an Steuergeld verteilt hat. Und wären eben bei der Cofag nicht dieselben Menschen am Ruder gewesen.
Denn der Nachfolger von Michael Mendel in der Abbag heißt ab 2016 Bernard Perner. 2013 stieg der studierte Techniker ins Finanzministerium ein, machte sich als Bankenexperte einen Namen, diente drei Ministern im Kabinett, bevor er eben in die Abbag ging.

Er war sicher maßgeblich an der Errichtung der Staatsholding Öbag beteiligt und sehr wahrscheinlich auch an der Vorstandswerdung von Thomas Schmid. Chats legen
Das hatte Schmid nicht vergessen. Kaum saß Schmid im Chefbüro der Öbag in der Wiener Kolingasse, wollte er Perner als Prokuristen zu sich holen. Zu dieser Zeit arbeitete Perner nur noch rund zehn Stunden in der Woche für die Abbag. Tagesfüllend war das nicht. Perner erkundigte sich daraufhin im Finanzministerium, ob eine zusätzliche Beschäftigung in der Öbag möglich wäre. Er legte dem Ministerium auch einen Vertragsentwurf vor. Erstellt von den Rechtsanwälten von Schönherr.
Demnach sollte Perner berechtigt sein, „das Ausmaß und die Lage nach eigenem pflichtgemäßen Ermessen frei zu bestimmen“. Außerdem sei zusätzlich zu den laufenden Bezügen „eine variable Vergütung bei Erfüllung bestimmter Kriterien […] geplant. Die näheren Bestimmungen für diese variable Vergütung, inklusive der Festlegung bestimmter Kriterien, […] werden durch die ÖBAG noch festgelegt und sind in einer Zusatzvereinbarung [...] festzuhalten.“ Behielt Perner sich vor, mögliche Erfolge ähnlich wie Mendel nachträglich versilbern zu lassen?
Er selbst weist das von sich. Es habe diese Vereinbarung gegeben, ja, sagt er im Gespräch. Sie sei an die Dividendenausschüttung der Öbag-Beteiligungen geknüpft
Zum Beispiel zu dem aufgeblähten Cofag-Aufsichtsrat, der sich Gagen wie jene eines börsennotierten Unternehmens ausbezahlen und gleichzeitig den Bund die Haftung übernehmen ließ? „Die Bezüge wurden von einem Wirtschaftsprüfer in einer Benchmarking-Studie erhoben und dann noch vom Finanzministerium als Eigentümervertreter gekürzt.“
Zur auffälligen Nähe zu Rechtsanwälten? Er habe mit Rechtsanwälten zusammengearbeitet, denen er vertraue.
Zur Cofag insgesamt: „Wir wollten unseren Beitrag zur Bewältigung der Pandemie leisten und einen guten Job machen.“
Einen guten Job? Diesem Urteil wollen nicht alle zustimmen. Die grüne Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli spricht von einer „Selbstbedienungsmentalität der türkisen Clique“.
Eingespielte „Netzwerke“, die die staatliche Hoheit aushöhlten, erkennt der Präsident der Finanzprokurator, Wolfgang Peschorn. Im Ibiza-U-Ausschuss im April 2022 nannte er die Kungeleien ein „schleichendes Gift für den Rechtsstaat“.
Nachsatz: „Es sind dies jeweils aus dem gemeinsamen Interesse entstehende Seilschaften von privaten Personen, LawFirms, Wirtschaftsberatern und politiknahen Personen, die auf Entscheidungsträger einwirken.“
Im Falle der Cofag scheint dies funktioniert zu haben. 14 Millionen Euro gingen in den ersten 15 Monaten nach ihrer Gründung an externe Berater. Schönherr Rechtsanwälte und die KPMG haben besonders von diesen Aufträgen profitiert. F

100 % FOTOS: APA/GEORG HOCHMUTH; APA/HERBERT NEUBAUER POLITIK FALTER 34/22 13
renommierter Wiener Fremdenrechtsanwalt, vertritt Tina
Tina mit ihrem Schülervisum, mit dem sie nach der Abschiebung nach Wien zurückkehren konnte

Tina wird nicht die Letzte sein
Die Abschiebung des georgischstämmigen Mädchens Tina im Jänner 2021 war gesetzeswidrig. Wird dies die ÖVP künftig daran hindern, aus der inszenierten Härte politisches Kapital zu schlagen?
I n der Nacht des 28. Jänner 2021, als Tina abgeschoben wurde, schlug Karl Nehammer, damals ÖVP-Innenminister, vor der Kamera der „ZiB 2“ die Augen nieder, andächtig und offensichtlich bedrückt. Ihre Abschiebung mache ihn „sehr betroffen“. Die Stille, die daraufhin folgte, erschien einen Moment lang wie eine Weggabelung: Würde dieser ÖVP-Innenminister als Nächstes sagen, dass Tinas Abschiebung ein Fehler sei? Dass es andere Lösungen bräuchte, gerade für Kinder? Es war ihm zuzutrauen.
Nehammers eruptive Art ist inzwischen fast schon berüchtigt; zuletzt sorgte er etwa mit einem Sager über Alkohol und Psychopharmaka im Zusammenhang mit der Energiekrise für Aufsehen. Würde es auch im Fall der Abschiebungen mit ihm durchgehen, nur auf andere Art? Würde er Tinas Deportation als sinnlose Brutalität gegen Kinder bezeichnen?
Nein, Nehammer bog im Jänner 2021 beim Thema Abschiebung nach rechts ab, so wie alle anderen ÖVP-Innenminister vor ihm auch: „Es macht mich sehr betroffen, dass die Eltern dieser Kinder sie in diese Lage gebracht haben; dass die Eltern bewusst das Asylrecht missbraucht haben.“ Tinas Mutter lebte jahrelang illegal im Land, wider-
setzte sich der Abschiebung. Ihre Tricksereien sind unbestritten. Genau deshalb wäre der Verzicht auf die Abschiebung „Amtsmissbrauch“, sagte Nehammer. Deshalb also auch keine Gnade für Tina.
Dabei hätte Tina gar keine Gnade nötig gehabt. Denn das Mädchen hatte das Recht darauf, in Österreich zu bleiben – trotz des Fehlverhaltens der Mutter.
Das besagt nun endgültig ein Entscheid des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH). Tinas Mutter stammt aus Georgien, das Mädchen ist aber in Österreich geboren, hat die meiste Zeit seines Lebens in Österreich verbracht und war hier gut eingelebt. Und weil Tina aufgrund der Europäischen Menschenrechtskonvention Artikel 8 ein Recht auf Familienleben hat und deshalb von ihrer Familie nicht getrennt werden kann, gilt dies auch für ihre Mutter und ihre Schwester. Die Abschiebung der gesamten Familie war also rechtswidrig.
Das Bundesverwaltungsgericht hatte dies bereits im Jänner erklärt. Nichtsdestotrotz legte das Innenministerium aber beim Verwaltungsgerichtshof eine sogenannte Amtsrevision ein – und bekam nun die endgültige Abfuhr. Die Rechtsmeinung, dass die Abschiebung unzulässig war, sei vertretbar. Das alles ändert nichts an der Justament-Position des ÖVP-geführten In-
nenministeriums oder von Karl Nehammer. Es würde auch nicht in die Logik der ÖVP passen, die sich bürgerlich gibt, aber in der Ausländerfrage bei jeder Gelegenheit den Hardliner markiert; beklatscht von Medien wie dem Kurier, in dem Chefredakteurin Martina Salomon etwa im Fall Tina schrieb, es sei „brandgefährlich, geltendes Recht gegen ,gesundes Volksempfinden‘ zu tauschen und Urteile je nach Social-MediaAufregung zu fällen“.

Was aussieht wie saubere Paragrafen, ist Propaganda. Ihre Härte und Entschlossenheit im Wettrennen mit der FPÖ um die Stimmen der rechten Wählerinnen und Wähler exerziert die ÖVP am überzeugendsten beim Asylthema.
Ein Beispiel: Als die Taliban vor einem Jahr Kabul überrannten und die Menschen sich in ihrer Verzweiflung an startende Flugzeuge klammerten, um außer Landes zu kommen, sagte Nehammer in einem Interview mit der Kleinen Zeitung: „Wir müssen so lange wie möglich abschieben.“
Gerade wenn es um die Abschiebung von Kindern geht, hat diese Haltung der ÖVP Tradition. Etwa im Fall des kosovarischen Mädchens Arigona Zogaj. Die damals 15-Jährige war 2007 untergetaucht und ließ per Videobotschaft alle Welt wissen,
14 FALTER 34/22 POLITIK
CHRONOLOGIE: NINA BRNADA FOTOS: ROBERT NEWALD/PICTUREDESK.COM (2)
dass sie sich lieber das Leben nehmen würde, als außer Landes gebracht zu werden. Der damalige ÖVP-Innenminister Günther Platter, heute (noch) Landeshauptmann von Tirol, ließ sich davon nicht erweichen und meinte nur: „Recht muss Recht bleiben.“ Maria Fekter, Platters ÖVP-Parteikollegin und Nachfolgerin im Innenressort, legte bei Zogaj sogar noch eins drauf: „Ich habe nach den Gesetzen vorzugehen, egal ob mich Rehlein-Augen aus dem Fernseher anstarren oder nicht.“


Oder der Fall von Daniela und Dorentinya – bekannt als Komani-Zwillinge. 2010 wurden die damals achtjährigen Mädchen abgeschoben, ebenfalls in den Kosovo. Dafür ließ das Innenministerium die Fremdenpolizei mit Maschinengewehren in ihr Kinderzimmer anrücken.

Diesem Drehbuch folgte auch Tinas Abschiebung Ende Jänner 2021. Bei ihr stand gerade das Abendessen auf dem Tisch, als die Polizei kam. Eine halbe Stunde hatte das Mädchen, das Wichtigste aus seinem Leben in Österreich einzupacken. Sie habe Angst, tippte die damals Zwölfjährige in die Whatsapp-Gruppe ihrer Klasse des Wiener Gymnasiums Stubenbastei.
In dieser Winternacht standen Wega-Beamte Schulter an Schulter vor dem Simmeringer Anhaltezentrum Zinnergasse. Wenige Wochen zuvor hatten sie den islamistischen Terroristen Kujtim F. in der Wiener Innenstadt erschossen. Jetzt trotzten sie, flankiert von Hunden, einer Barrikade von Tinas Freunden, Gymnasiasten, die sich der Abschiebung ihrer Klassenkameradin widersetzten.
Gegen zwei Uhr morgens wurden Tina, die Schwester, die Mutter und noch andere Kinder weggebracht. „Es waren alle Gefühle auf einmal“, sagte das Mädchen später in einem „ZiB 2“-Interview: „Trauer, Wut auf irgendeine Weise und Angst.“

Tinas Abschiebung war auch ein neuer Tiefpunkt zwischen ÖVP und Grünen. Etliche Abgeordnete der Grünen protestierten in dieser Nacht gegen die Maßnahme. Viele von ihnen tief betroffen – waren sie es doch, die über Jahrzehnte Missstände im Asylwesen aufgezeigt hatten.

Doch darauf nahm der Koalitionspartner ÖVP keinerlei Rücksicht. Bereits das zweite Mal hatte die Volkspartei die Grünen öffentlich brüskiert. Das erste Mal geschah dies bei der Diskussion um das griechische Flüchtlingslager Moria – die Grünen forderten, zumindest Kinder von dort aufzunehmen. „Unsere Linie bleibt unverändert“, hatte daraufhin Alexander Schallenberg, auch damals Außenminister, gesagt.
Nach Tinas Abschiebung verkündete Werner Kogler, der grüne Vizekanzler, die Schaffung einer Kindeswohlkommission unter dem Vorsitz von Irmgard Griss, der ehemaligen Präsidentin des Obersten Gerichtshofs (Präsidentschaftskandidatin von 2017 und spätere Neos-Abgeordnete), angesiedelt im grün geführten Justizministerium. Es war das Einzige, was die Grünen tun konnten . „Anfangs war ich sehr skeptisch gegenüber dieser Kommission, denn darin saßen wenige Praktiker aus dem Asylbereich“, sagt Lukas Gahleitner-Gertz, Sprecher der NGO Asylkoordination. „Man muss aber sagen, dass sie sehr gute Arbeit geleistet hat.“

Die Griss-Kommission konnte allerdings von Anfang an keinen Einfluss auf Fälle wie den von Tina nehmen – ihre Aufgabe war eine Art Ad-hoc-Monitoring über den Schutz der Kinderrechte im Asyl- und Fremdenrecht. Im Juni 2021 endete ihre
Arbeit mit der Veröffentlichung eines 234 Seiten langen Berichts, der Vorschläge zur Verbesserung in Fragen des Kindeswohls in Asylverfahren enthielt: etwa die Einrichtung eines ständigen, unabhängigen Monitoringsystems.
Die Griss-Kommission gibt es nicht mehr, sie war ohnehin nicht als Dauereinrichtung angelegt. Ebenso wenig wurden ihre Vorschläge beherzigt. Zwar sei in letzter Zeit oft darüber gesprochen worden, dass viele der Empfehlungen umgesetzt worden seien, so die ehemalige Kommissionsvorsitzende Griss. Doch „das ist nicht der Fall“, sagte sie ein Jahr nach dem Erscheinen des Berichts bei einer Pressekonferenz.
Auch eine Erhebung von 26 Studierenden der Universität Wien im Rahmen der Refugee Law Clinic, einer Lehrveranstaltung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, fiel ernüchternd aus. Die Refugee Law Clinic hatte kurz nach dem Erscheinen des Kommissionsberichts für den Zeitraum von mehr als einem halben Jahr die Entscheidungen in Asylverfahren von Kindern darauf untersucht, ob die Empfehlungen Eingang in die Praxis gefunden haben.
Fazit: Zwar wurde etwa die „psychische und physische Gesundheit des Kindes“ von der Richterschaft in über 70 Prozent der untersuchten Entscheidungen berücksichtigt. Aber: „Die Entscheidungen arbeiten überwiegend mit Textbausteinen, ohne auf den konkreten Fall, das heißt die individuelle Situation des Kindes, einzugehen“, sagte Sinaida Horvath von der Universität Wien.
All das hat längst nichts mehr mit Tina zu tun. Nachdem sie abgeschoben worden war, kehrte sie im Mai 2021 mit einem Schülervisum zurück. Seither wohnt sie
bei einer Wiener Gastfamilie, die sie auch finanziell unterstützt.
Ihre Mutter und Schwester leben zwar noch in Georgien, doch „die Tendenz ist, dass sie auch nach Österreich zurückkommen werden“, sagt Wilfried Embacher, Tinas Anwalt. Jetzt dürfen sie es ja. Hier würden sie wohl ein Bleiberecht bekommen – etwas, was die Behörden schon davor hätten gewähren können. Man werde wohl auch Amtshaftungsansprüche geltend machen, also eine Entschädigung einfordern –welche Summe genau, das könne er nicht sagen, bis Jänner 2024 läuft jedenfalls die Frist, sagt Embacher.
Werden durch den Anlassfall Tina nun Kinderrechte gestärkt? Oder andere nach dem Vorbild ihrer Mutter die Verfahren ebenfalls hinauszögern und so einen Aufenthalt in Österreich erzwingen?
Dass die Menschen Verschiedenes probierten, um bleiben zu können, sei klar – „das gab es schon immer“, sagt Embacher. Die Behörden sollen schneller entscheiden, also auch schneller abschieben. „Faktum ist aber, dass wir nie die Kapazitäten haben werden, um alle abzuschieben – das ist allen Beteiligten völlig klar. Die Politik muss endlich den Mut aufbringen, die Wahrheit zu sagen, und nicht von Abschiebungen nach Afghanistan fantasieren, wenn sie selbst bei Armenien und Georgien Schwierigkeiten hat.“
Die Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper wollte in einer parlamentarischen Anfrage vom Innenministerium wissen, ob es denn eine „offizielle Entschuldigung“ oder eine „andere Form der Wiedergutmachung“ im Fall Tina in Erwägung ziehe. Die Antwort war ein glattes „Nein“. F
POLITIK FALTER 34/22 15 FOTOS: APA/GEORG HOCHMUTH, APA/EXPA/JOHANN GRODER, APA/HERBERT
APA/MANFRED
NEUBAUER,
FESL, APA/HELMUT FOHRINGER, APA/CHRISTOPHER GLANZL
Arigona Zogaj sollte 2007 abgeschoben werden, sie tauchte daraufhin unter (links). Die KomaniZwillinge wurden 2010 abgeschoben, die Fremdenpolizei rückte dafür mit Maschinengewehren an
minister Nehammer: Tina nicht abzuschieben wäre „Amtsmissbrauch“
Ex-ÖVP-Innenminister Günther Platter im Fall Arigona: „Recht muss Recht bleiben“
ministerin Maria Fekter spottete über Arigonas „Rehlein-Augen“
Die Schülerproteste in der Zinnergasse gegen Tinas Abschiebung flankieren Dutzende Polizisten
»
Die Politik muss endlich den Mut aufbringen, die Wahrheit zu sagen
WILFRIED EMBACHER
Altbau, ein bisschen moderne Kunst an den Wänden, die Möbel ein wenig abgewohnt, eine betagte Dackeldame schleicht zwischen den Sesselbeinen des Besprechungszimmers herum. Nichts in der Wiener Innenstadtkanzlei von Tassilo Wallentin vermittelt das Gefühl, dass hier ein politisches Start-up seine Zentrale hat. Außer vielleicht die zwei unterschriebenen Unterstützungserklärungen, die jemand auf dem Tisch hat liegen lassen.
Tassilo Wallentin will für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren.
Der 48-jährige Wiener tritt ohne die Unterstützung einer politischen Partei an, er ist nicht die Frontfigur einer Bürgerbewegung. Tassilo Wallentin ist Kolumnist der Kronen Zeitung. Seit beinahe zehn Jahren schreibt der Wiener Rechtsanwalt in der Wochenendbeilage der Krone, was die Menschen lesen wollen. Sein Gespür für das Publikum von Österreichs auflagenstärkster Zeitung will er jetzt politisch verwerten.
Die publizistische Karriere von Tassilo Wallentin beginnt mit einem Rücktritt. Als Papst Benedikt XVI. im Februar 2013 sein Amt als höchster Funktionär der katholischen Kirche zurücklegt, hat Wallentin gerade einen Termin in der Redaktion der Kronen Zeitung in der Muthgasse. Er ist mit Herausgeber Christoph Dichand seit vielen Jahren gut bekannt und vertrat ihn gelegentlich als Rechtsanwalt. „Ich hatte alle theologischen Schriften von Benedikt gelesen und bot an, eine Glosse über ihn zu schreiben“, erzählt Tassilo Wallentin. Seitdem schreibt er regelmäßig in der Krone bunt und erhält viel Applaus auf den Leserbriefseiten. Seine Kolumnen verkaufen sich auch in Buchform gut.
In seiner Kolumne „Offen gesagt“ bedient Tassilo Wallentin den klassischen Kanon der Kronen Zeitung: EU-Bürokratie, Massenzuwanderung, abgehobene Eliten. Allerdings kommt bei Wallentin auch eine gewaltige Portion Endzeitstimmung dazu. Seine Texte lesen sich teilweise wie vom Algorithmus einer Telegram-Gruppe von Verschwörungstheoretikern ausgespuckt. Nach der Corona-Pandemie befürchtet Wallentin den „großen Reset“ mit einem allmächtigen Staat, totaler Kontrolle der Bürger, der Abschaffung des Bargelds. Dazu kommt die Angst vor dem Vermögensverlust, die Wallentin von Beginn seiner Kolumnistentätigkeit an begleitet.
Dabei vermittelt er seinen Lesern oft, dass er einen Blick hinter die von den Mächtigen aufgebauten Kulissen wirft. Schon 2013 entdeckte er „auf Seite 49 eines 107 Seiten starken Berichtes des IWF“ den Plan „einer Zwangsabgabe von 10 % auf alle Privatvermögen der Bürger“. Das von Wallentin skizzierte Szenario: „Es soll zu einer Enteignungswelle kommen. Auch für Haushalte, die über ganz geringe Ersparnisse verfügen.“ Das Thema „Massenenteignungen“ beschäftigt ihn bis heute. Erst vor wenigen Wochen warnte er wieder vor „Massenenteignung durch Zwangsabgaben, Einfrieren von Sparguthaben, Einziehung von Goldmünzen“.
Anwalt Angstlust

Rechtsanwalt und Krone-Kolumnist Tassilo Wallentin will Bundespräsident werden. Mit düsteren Prophezeiungen und einem autoritären Amtsverständnis
PORTRÄT: JOSEF REDL
Dafür, dass er diese vermeintlich unangenehmen Wahrheiten ausspricht, erhält Tassilo Wallentin viel Zustimmung. Diese Stimmung beschreibt er so: „Immer mehr Menschen spüren, dass es so nicht weitergehen kann. Das ist natürlich eine Gefahr für die abgehobenen Eliten aus Politik und Wirtschaft, die es sich mit ihren Privilegien und Pfründen sehr bequem eingerichtet haben.“
Beinahe würde er selbst schon zu den Eliten zählen. Nach der Nationalratswahl 2017 paktierten ÖVP und FPÖ in einem Sideletter zu ihrer Regierungsübereinkunft Personalfragen. Tassilo Wallentin war dabei als Verfassungsrichter vorgesehen. Seine Bestellung dürfte jedoch am Veto von Bundespräsident Alexander Van der Bellen gescheitert sein. Im Sideletter von ÖVP und FPÖ stand neben Wallentins Namen „unabhängig“. Aber ein Naheverhältnis zu den Freiheitlichen ist evident. Er war Rechtsanwalt des früheren Dritten Nationalratspräsidenten Martin Graf (FPÖ). Für Heinz-Christian Strache brachte er im Jahr 2012 eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof gegen den EuroRettungsschirm ESM ein. Und zuletzt verhandelte er über mehrere Wochen hinweg mit Parteichef Herbert Kickl über einen Antritt bei der Bundespräsidentenwahl auf einem FPÖ-Ticket.
Der Grund für sein Antreten ist so etwas wie Notwehr: „Das Land fährt politisch gegen die Wand“, sagt Wallentin. Seine Vorstellung vom Präsidenten ist eine autoritäre. Noch bevor er überhaupt die notwendigen 6000 Unterstützungserklärungen beisammenhat, liebäugelt er damit, die Regierung zu entlassen:
„Wenn jemand offensichtlich nicht in der Lage ist, ein Land zu führen, und das in einer Extremsituation endet, dann kann man als Bundespräsident nicht zuschauen.“ Wie er sich das genau vorstellt? „Ich sage denen nicht, was sie zu tun haben. Aber man muss mir ein Konzept vorlegen, von dem ich sage: Das macht Sinn“, sagt Wallentin. Nach welchen Kriterien er über die Sinnhaftigkeit politischer Konzepte entscheidet? „Am Schluss ist das immer eine Ermessensfrage.“
Geht es um die eigene Wahlkampagne, bleibt der sonst so thesenstarke Rechtsanwalt vage. Es gibt schon „gewisse Personen“, die ihm helfen, aber das sei „alles im Aufbau“. Wer diese Menschen sind und was sie genau machen, verrät er nicht. Nur das ist ihm wichtig: Ein klassischer Parteimanager oder gar ein Spindoktor sind nicht darunter.
Seine Kolumne hat Tassilo Wallentin für die Dauer des Wahlkampfes ausgesetzt. Verzichten will er auf die Kronen Zeitung aber nicht. Am Sonntag buchte er drei ganze Seiten in der Wochenendbeilage inklusive Unterstützungserklärung zum Ausschneiden. Die Kosten – der Listenpreis liegt bei über 110.000 Euro – hat der Industrielle und frühere Parteigründer Frank Stronach übernommen.
Im Preis inbegriffen: ein Geburtstagsinterview mit dem austrokanadischen Milliardär.
16 FALTER 34/22 POLITIK
Tassilo Wallentin (48)
Der Wiener maturierte bei den Schulbrüdern in Strebersdorf, sein Jus-Studium absolvierte er in Salzburg. Als Rechtsanwalt vertrat er die Familie Dichand in einem Schiedsverfahren gegen die WAZ-Gruppe. Zu seinen Klienten gehörten auch der frühere Dritte Nationalratspräsident Martin Graf (FPÖ) und Ex-Bawag-Chef Helmut Elsner
F
FOTO: HERIBERT CORN
„Die Sanktionen verhindern Kriegsverbrechen!“
Der russische Ökonom Sergej Guriev über den Sinn von Strafmaßnahmen gegen Russland. Und welche Rolle Abweichler spielen
INTERVIEW: EVA KONZETT
Seit mehr als einem halben Jahr herrscht Krieg in Europa. Russland hat am 24. Februar 2022 seinen Nachbarn, die Ukraine, überfallen. Seit Sommer 2021 hatte sich die EU darauf vorbereitet. Auch deshalb konnten die EU-Mitgliedsstaaten nach dem Angriff schnell reagieren. Sie haben russische Geldreserven im Ausland eingefroren, russische Unternehmen aus dem weltweiten Zahlungsabwickler Swift ausgeschlossen, russische Oligarchen und Weggefährten des Präsidenten Wladimir Putin sanktioniert. Ende des Jahres soll ein Ölembargo kommen. Doch die Kosten sind hoch. Vor allem die Preise für Erdgas steigen rasant, die Inflation ebenso. Regierungen fürchten den Herbst und vor allem den Winter. Und eine Frage steht im Raum: Was, wenn die ganzen Bemühungen umsonst sind? Der Falter hat bei dem russischen Ökonomen Sergej Guriev nachgefragt.
Falter: Herr Guriev, in Österreich ist eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit der Sanktionen gegen Russland entbrannt. Wirken diese denn überhaupt?
Sergej Guriev: Ja, das tun sie. Wir sehen bereits einen großen Einfluss auf die russische Wirtschaft. Wenn Europäer sich darüber beklagen, dass die Preise steigen und dass es möglicherweise eine Rezession in mehreren europäischen Ländern und den USA geben wird, sollten wir nicht vergessen, dass Russland schon einen Wirtschaftsrückgang erleidet und sehr hohe Inflationszahlen hat. Die russische Wirtschaft ist im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten schon um sechs Prozent geschrumpft. Sechs Prozent von Quartal zu Quartal bedeuten, dass die russische Wirtschaft im Jahresvergleich um 20 Prozent eingebrochen ist. Die Geschwindigkeit des Einbruchs ist hoch. Russland hat so etwas in diesem Jahrhundert noch nicht erlebt.

Was führt dazu?
Guriev: Da spielt vor allem hinein, dass die russischen Fremdwährungsreserven im Ausland eingefroren sind. Das zweite Hindernis sind die Handelsembargos. Zum einen haben die westlichen Staaten einen Bann für den Export von Komponenten der Hochtechnologie verhängt. Den größten Schock für die russische Wirtschaft haben aber westliche Unternehmen verursacht, die freiwillig den russischen Markt verlassen haben. Mehr als 1000 globale Konzerne haben Russland bis dato den Rücken gekehrt. Das hat dazu geführt, dass auch die russischen Importe um die Hälfte eingebrochen sind. Und das geht an den verarbeitenden Betrieben nicht vorbei. Die Autoproduktion in Russland ist im Juni im Jahresvergleich um den Faktor zehn geschrumpft. Das ist ein
großer Schock. Das zeigt, dass die russische Wirtschaft sehr viel stärker von den Sanktionen mitgenommen wird als die europäische.
Wie reagiert die russische Gesellschaft? Von Protesten hört man wenig.
Guriev: Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Russland ein sehr repressiver Staat ist, wo die Meinungsfreiheit nicht mehr gilt. Die Russen ärgert es sehr, dass sie auf ihre Dollar-Konten nicht mehr zugreifen, dass sie ihre Ersparnisse nicht mehr dafür verwenden können, ins Ausland zu reisen. Sie protestieren nicht offen dagegen, weil es ihnen nicht möglich ist. Öffentlich gegen den Krieg in der Ukraine aufzutreten kann eine Gefängnisstrafe von 15 Jahren mit sich bringen.
Die EU ist nach dem russischen Angriff auf die Ukraine vom 24. Februar 2022 geschlossen aufgetreten. Angesichts der steigenden Energiepreise machen sich Risse in dieser Einheit bemerkbar. In Österreich sprechen sich die ersten hochrangigen ÖVP-Politiker dafür aus, die Sanktionen zu überdenken. Was für Folgen könnte das haben?
Guriev: Die Geschlossenheit ist extrem wichtig. Die wichtigste Strafmaßnahme haben die Europäer im Mai beschlossen, aber noch nicht umgesetzt. Ich spreche von einem Embargo auf russisches Öl. Für Russland sind die Einnahmen aus den Exportgeschäften mit Erdöl und Erdgas überlebenswichtig. Und die Hälfte davon geht in die EU. Wenn die EU gemeinsam mit den USA ein Embargo auf Öl erlässt und sogenannte Secundary Sanctions beschließt, also auch Drittstaaten dafür bestraft, Ölgeschäfte mit Russland zu machen, dann hat Wladimir Putin keine Einnahmen mehr. Die Steuereinnahmen sind ohnehin schon stark geschrumpft, weil das Land sich in einer Rezession befindet. Wenn das Ölembargo ab Dezember wie vereinbart tat-
sächlich in Kraft tritt, wird es Russland sehr schwächen.
Inwiefern liefern Politiker, die die Sanktionen hinterfragen, Russland eine Steilvorlage?
Guriev: In großem Ausmaß. Wladimir Putin hat viele Freunde in Europa. Weil sie nicht mehr offen sagen können, den Kriegstreiber Putin zu unterstützen, reden sie sich nun auf die Sanktionen aus. Die Erzählung ist immer dieselbe: Die Sanktionen würden die europäische Wirtschaft mehr treffen als Putin. Das stimmt aber nicht. Das entspricht nicht den Fakten, egal wie oft es populistische Politiker von rechts und links wiederholen.
Was würde passieren, wenn einzelne Staaten die Sanktionen unterliefen?
Guriev: Eine Sache ist klar: Dieser Krieg wird auf dem Schlachtfeld entschieden werden. Es ist daher entscheidend, ob und wie viele Waffen der Westen an die Ukraine liefert. Und wie lange Putin selber noch Waffen produzieren kann. Was wir bereits sehen ist Folgendes: Das Exportverbot für Halbleiter nach Russland, für die Motoren von Jagdfliegern, der Bann von qualitativ hochwertigem Stahl, all das hat Russlands Möglichkeiten, moderne
Waffen zu produzieren, drastisch eingeschränkt. Putin hat schon in China und sogar im Iran um Waffen angefragt. Er packt alte Panzer aus der Sowjetzeit wieder aus. Die funktionieren zwar nicht mehr richtig, aber er hat zu viele moderne Panzer in der Ukraine verloren und die, die kaputt sind, können nicht mehr repariert werden. Es fehlt schlichtweg an den dafür notwendigen Komponenten. Wir müssen uns über eine Sache im Klaren sein: Wir können Putins Willen mit den Sanktionen nicht ändern. Aber wir können ihn daran hindern, seinen Willen durchzusetzen.
Was meinen Sie damit?
Guriev: Schauen Sie, Putin hat schon Probleme, Soldaten zu rekrutieren. Die Wagner-Gruppe (eine Söldnerarmee, Anm.) muss in die Gefängnisse gehen, um neue Kämpfer zu finden. Im russischen Staatsfernsehen wird schon um Söldner geworben. Putin braucht Geld, er braucht Devisen, um solche Männer zu bezahlen. Wenn Europa ihm diese Devisen verwehrt, kann er den Krieg nicht fortführen. Das kann Leben retten. Dafür müssen aber die Sanktionen aufrechtbleiben. Sie aufzuheben wäre ein Fehler, und das wäre letztlich ein Beitrag zu Kriegsverbrechen. F
POLITIK FALTER 34/22 17 FOTO: AFP/PICTUREDESK.COM/JOEL SAGET
Sergej Guriev ist einer der bekanntesten Ökonomen Russlands. Er floh 2013 nach Frankreich und amtierte von 2016 bis 2019 als Chefökonom der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD). Derzeit unterrichtet der 50-Jährige an der Pariser Eliteuniversität Science Po
SAGET/AFP/PICTUREDESK.COM Beim Reden kommen die Leut’ z’samm! Treffen Sie uns in Ihrer Nähe. WIR TOUREN FÜR SIE DURCH WIEN. alle Termine und Standorte finden Sie unter www.infotour.at 25. – 27.8.2022 Vorplatz Bahnhof Ottakring DU AK ÖGB Infotour_1160_Falter_24_08.indd 1 06.07.22 11:38
FOTO: JOEL
Sommer maximus
Einer der heißesten Sommer der Messgeschichte geht zu Ende. Ist das die neue Normalität?
Austrocknende Flüsse, schmelzende Gletscher, Waldbrände und Hitzerekorde in ganz Europa. Der Klimawandel macht sich immer stärker bemerkbar. Auch die Stürme, die vergangene Woche in Kärnten, der Steiermark und Niederösterreich fünf Todesopfer forderten, sind keine Ausnahme.
Dass der Sommer vom Temperaturanstieg besonders stark betroffen ist, zeigen Messungen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), die für Österreichs Wetter- und Klimaprognosen verantwortlich ist und über mehr als 260 Messstationen verfügt. Der diesjährige Sommer ist einer der heißesten seit Beginn der Aufzeichnungen. Wie kommen die Berechnungen zustande? Und ist das nun die neue Normalität?
Über Stockerlplätze will Alexander Orlik jedoch nicht streiten. Seit 19 Jahren beschäftigt er sich an der ZAMG mit dem heimischen Klima. Und endgültig Bilanz ziehen kann der Klimatologe erst Ende August. Dann ist der meteorologische Sommer vorbei. Die meteorologischen Jahreszeiten beginnen nämlich im Gegensatz zu den astronomischen, die exakt nach dem Sonnenstand berechnet werden, jeweils mit dem Monatsersten. Der Sommer dauert somit vom 1. Juni bis zum 31. August. Danach kann Orlik sagen, ob der heurige Sommer der dritt- oder viertheißeste Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen war.

Bereits jetzt ist aber klar, dass die Temperaturabweichung im Vergleich zum Mittel der Sommer 1991 bis 2020 groß sein wird. Von rund 1,8 Grad Celsius geht man aus, so Orlik. Nur die Sommer 2003 und 2019 waren heißer. Eventuell platziert sich 2022 noch knapp hinter 2015.
„Von den Sommern der vergangenen 256 Jahre waren nur zwei wärmer als dieser“, sagt Orlik. „Das spricht für sich.“ Vier von fünf der heißesten jemals gemessenen Sommer liegen nicht mehr als sieben Jahre zurück, der fünfte war im Jahr 2003. Auch 2022 wird sich in diese alarmierende Liste einreihen.
Wenn es um solche Listen geht, hat Österreich eine Vorreiterrolle. „28. December 1762, frigus maximus, Barometer 27° 2’“, die „größte Kälte“ vermerkten die Benediktinermönche des Stiftes Kremsmünster im ersten Eintrag ihres Klimatagebuches, seit 1767 sind die meteorologischen Aufzeichnungen durchgehend erhalten. Naturwissenschaften lagen damals im Trend, im Kloster wurde ein „mathematischer Turm“ eingerichtet, um der Forschung zu frönen. Eine Fensternische im ersten Stock diente als Wetterstation. Die Daten, die die Mönche damals aufzeichneten, sind für Klimatologen wie Orlik bis heute von Bedeutung.
Denn im Allgemeinen werden in der Klimatologie zur besseren Vergleichbarkeit Abweichungswerte zu langjährigen Durchschnitten herangezogen. Üblich ist etwa die Abweichung eines bestimmten Jahres zum Mittel eines 30-Jahre-Zeitraums, einer sogenannten Klimanormalperiode. Reiht man diese Abweichungen aneinander, kann man so anschaulich den langjährigen Temperaturanstieg darstellen.
Die bisher fünf heißesten Sommer in Österreich seit 1767 waren: 1./2. 2003 und 2019 ex aequo 3. 2015 4. 2017 5. 2018
Parallel dazu steigt die Zahl der Hitzetage (mit einer Lufttemperatur von mindestens 30 Grad im Schatten). So lag sie in Wien zwischen 1961 und 1990 bei durchschnittlich zehn, 1991 bis 2020 bei 21 pro Jahr
Dass dieser seit 1980 ununterbrochen stattfindet, sieht man auch anhand unterschiedlicher Vergleichszeiträume: Während die Abweichung des Rekordsommers 2019 zum Mittel der Sommer 1960 bis 1991 ganze 3,8 Grad Celsius beträgt, sind es im Vergleich zum Zeitraum 1991 bis 2020 nur noch 2,1 Grad.
Werden solche Sommer also bald zur Normalität? Allgemein sind kurz- bis mittelfristige Klimaschwankungen normal und lassen sich schwerer vorhersagen. Als beispielsweise 1815 auf der indonesischen Insel Sumbawa der Tambora ausbrach, erlebten Teile Nordamerikas und Europas 1816 ein „Jahr ohne Sommer“. Der Vulkanausbruch hatte Schwefelverbindungen in die Atmosphäre geschleudert, die sich wie ein Schleier um die Erde legten und das Klima jahrelang abkühlten.

Und langfristig? Da lässt sich der Temperaturanstieg relativ gut abschätzen, sagt Orlik: „Die heißen Sommer werden dann noch heißer.“ Auch andere Extremereignisse wie Tornados werden insgesamt häufiger. Dazu kommt: Die Jahreszeiten verschieben sich.
Während der Frühling, und damit auch die Gewittersaison, früher beginnt, rechnen Klimatologen wie Orlik im Sommer immer mehr mit lang anhaltenden Wetterlagen. Denn der Jetstream, ein dynamisches Starkwindfeld, verschiebt sich Richtung Norden. Hochdruckgebiete verweilen somit länger, mediterran anmutende Trockenphasen auch in Österreich sind die Folge. Kommt dann doch einmal ein Tiefdruckgebiet, bewegt sich dieses ebenfalls langsamer und sorgt für größere Regenmengen und heftige Gewitter – wie vergangene Woche in Teilen Österreichs.
Bleibt das nun für immer so? Das Erreichen der Klimaziele könnte solche Ereignisse noch etwas abfedern. Ein globales Plus von zwei Grad im Vergleich zu 1880, so heißt es im Übereinkommen von Paris aus dem Jahr 2015, höchstens 1,5 Grad im Sonderbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) von 2018.
Auch Österreich hat noch einiges zu tun. Hier beträgt die Abweichung bereits 2,5 Grad.
Mit der Vermenschlichung von Produkten und Marken, auch Anthropomorphismus genannt, beschäftige ich mich schon länger. Wir alle vermenschlichen nichtmenschliche Dinge – ob wir mit unserem Hund sprechen oder mit unserem Laptop schimpfen. Im Jahr 2015 stieß ich auf eine Forschungsarbeit, die zeigte, dass Probanden mehr Kekse aßen, wenn ein Gesicht draufgemalt war.
Die Erklärung lautete damals, dass die Teilnehmenden sich beim Essen weniger zügelten, weil sie das Gefühl hatten, die „Verantwortung“ an das Keks abzugeben. Beim Einkaufen hat das einen positiven Effekt – da greifen wir lieber zu. Ich frag-
te mich allerdings, wie es sein kann, dass man in ein Gesicht beißen will. Empfinden wir das nicht als grausam? Also führte ich selbst mehrere Experimente durch. Die Ergebnisse wurden vor kurzem im Journal of Consumer Psychology veröffentlicht.
Ich habe Untersuchungen mit Erwachsenen gemacht und herausgefunden, dass sie weniger Lust hatten, einen Apfel zu essen, nachdem sie eine Werbeanzeige gesehen hatten, in der ein Apfel ein Gesicht hatte. Wie ungern sie den Apfel essen wollten, hing davon ab, ob sie das Gefühl hatten, dass der Apfel Schmerz empfinden könne. Und das wiederum hatte mit ihrer Kaltherzigkeit zu tun, also ob sie sich selbst
als Menschen einschätzten, die die Gefühle anderer gut nachempfinden konnten. Je mehr jemand einen Apfel als Person sah, desto weniger wollte er ihn essen.
Meine Ergebnisse widersprechen der Forschungsarbeit von 2015 nicht unbedingt. Während damals Südkoreaner befragt wurden, untersuchte ich Österreicher und USAmerikaner. Kulturelle Unterschiede sind also eine mögliche Antwort; wir leben vielleicht ungehemmter und kommen deshalb weniger in Versuchung, die Verantwortung für ungezügeltes Verhalten, wie das Essen eines Kekses, auf das Produkt zu schieben.
18 FALTER 34/22 WISSENSCHAFT
Beißen wir lieber in Kekse, die ein Gesicht haben, Herr Schroll?
Roland Schroll ist Assistenzprofessor für Marketing an der Universität Innsbruck
ILLUSTRATION: OLIVER HOFMANN; FOTO: ROLAND SCHROLL
Wissenschaftler der Woche Roland Schroll
PROTOKOLL: ANNA GOLDENBERG
BERICHT: SIMON STEINER
BLATTKRITIK
Identitätspolitik, psychische Gesundheit, Rassismus. Roxane Gay kennt man von ihren Kolumnen in der New York Times, in denen sie sich mit reflektierter Schärfe zu jenen Themen äußert, die zwischen Tabu und Aufreger oszillieren. Die 47-jährige US-Amerikanerin, deren Eltern aus Haiti stammen, ist zudem die Autorin mehrerer Bücher und Englischprofessorin, zuletzt an der Yale-Universität. Auf Twitter folgen ihr knapp 900.000 User, wenn Gay etwas sagt, wird es gehört.

Und dennoch setzt sie seit anderthalb Jahren auf ein Medium, das man ohne weiters als „Old School“ bezeichnen kann:
den E-Mail-Newsletter. „The Audacity“, zu Deutsch „Kühnheit“, aber auch „Unverschämtheit“ heißen ihre wöchentlichen Schreiben, die man beim US-Anbieter Substack abonnieren kann. In der Gratisversion bekommt man eine wöchentliche Liste mit Lesetipps, garniert mit Gays schnoddrigen Kommentaren.
Was „The Audacity“ besonders macht, ist, dass Gay ihre Reichweite nutzt, um Jungtalente zu fördern. Alle zwei Wochen gibt es eine Kurzgeschichte oder einen Essay von einer Nachwuchsschreiberin oder einem Nachwuchsschreiber; für die Veröffentlichung erhalten sie ein Honorar. In der aktuellen Ausgabe schreibt Tanya Llanas über Astronomie und ihre lateinamerikanische Herkunft. Lesenswert.
ANNA GOLDENBERG
WATCHDOG
DIGITALMEDIEN BESCHWEREN SICH


Stolze 54 Millionen Euro wird der neue Fonds zur Förderung der digitalen Transformation heuer an Medien, die sich an ein österreichisches Publikum richten und ihre Digitalisierung vorantreiben wollen, ausschütten. Ausgeschlossen sind davon allerdings reine Digitalmedien. Und die beschweren sich nun. Am Montag endete die Einreichfrist, am selben Tag veröffentlichten die Plattformen Trending Topics, Andererseits und das in Gründung befindliche Start-up Projekt I einen offenen Brief an Medienministerin Susanne Raab (ÖVP). Die Förderung verzerre den Wettbewerb und verstoße deshalb gegen das EU-Beihilfenrecht.
ERSCHEINUNG
RBB-GESCHÄFTSFÜHRUNG MUSS GEHEN

Die Bestnote war leicht zu erreichen. Ende Juni deckte die deutsche Nachrichtenseite Business Insider ein geheimes Bonussystem auf, das den Topkräften des deutschen öffentlich-rechtlichen Senders Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) großzügige Prämien auszahlte. Intendantin Patricia Schlesinger erhielt zuletzt ein Jahresgehalt von 303.000 Euro. Zudem soll sie Vetternwirtschaft betrieben haben. Anfang August trat sie zurück. Am Samstag gaben die Intendanten der acht weiteren Anstalten, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunkverband ARD bilden, der verbleibenden RBB-Geschäftsführung die schlechteste Note: Sie entzogen das Vertrauen.
LEXIKON
PERIODEN-PRIVATSPHÄRE
Nachdem das bundesweite Recht auf Abtreibung in den USA gekippt worden war, gingen im Juni Tweets viral, die Frauen empfahlen, ihre Perioden-Apps zu löschen. Behörden könnten die gespeicherten Daten nach illegalen Schwangerschaftsabbrüchen durchsuchen. Die Mozilla Foundation hat nun die Privatsphäre- und Sicherheitseinstellungen von 25 Apps für das Tracking von Menstruation und Schwangerschaft untersucht. Nur sieben davon sind unbedenklich. Die deutsche App Clue beispielsweise, die sich an die strengen EU-Datenschutzgesetze hält, lässt einfache Passwörter zu – ein Sicherheitsrisiko auch außerhalb der USA.
FALTER 34/22 19 FOTOS: APA/AFP/LISA O’CONNOR, APA/GEORG HOCHMUTH, APA/DPA-ZENTRALBILD/BRITTA PEDERSEN, APA/DPA/SEBASTIAN GOLLNOW
Vom Friedhof der sozialen Netzwerke entfleuchen immer wieder Untote. So erging es beispielsweise Clubhouse. Seid endlich echt!, Seite 20
MEDIEN
DER
UNVERSCHÄMT KÜHN: „THE AUDACITY“,
NEWSLETTER DER SCHARFZÜNGIGEN US-AUTORIN ROXANE GAY
Alle zwei Wochen überlässt Roxane Gay ihre Plattform einem schreiberischen Jungtalent
Am besten gut kopiert
Von StudiVZ bis BeReal – seit 20 Jahren gibt es im Internet soziale Medien.
Um zu überleben, ahmt jeder jeden nach. Nun wollen alle wie TikTok sein.
Kann das gutgehen?
Jetzt also BeReal. Wenn die tägliche Benachrichtigung am Bildschirm des Smartphones aufploppt, ist es so weit: Die App gibt Userinnen und Usern ein zweiminütiges Zeitfenster, um zwei Fotos aufzunehmen – das, was man gerade sieht, und ein Selfie. Der Zeitpunkt, zu dem die Benachrichtigung kommt, ist stets ein anderer. Lädt man zu spät hoch, gibt es eine Rüge. Erst wenn die Fotos hochgeladen sind, wird sichtbar, was die anderen gepostet haben. Bis zur nächsten Runde verschwinden die Fotoeinträge wieder.


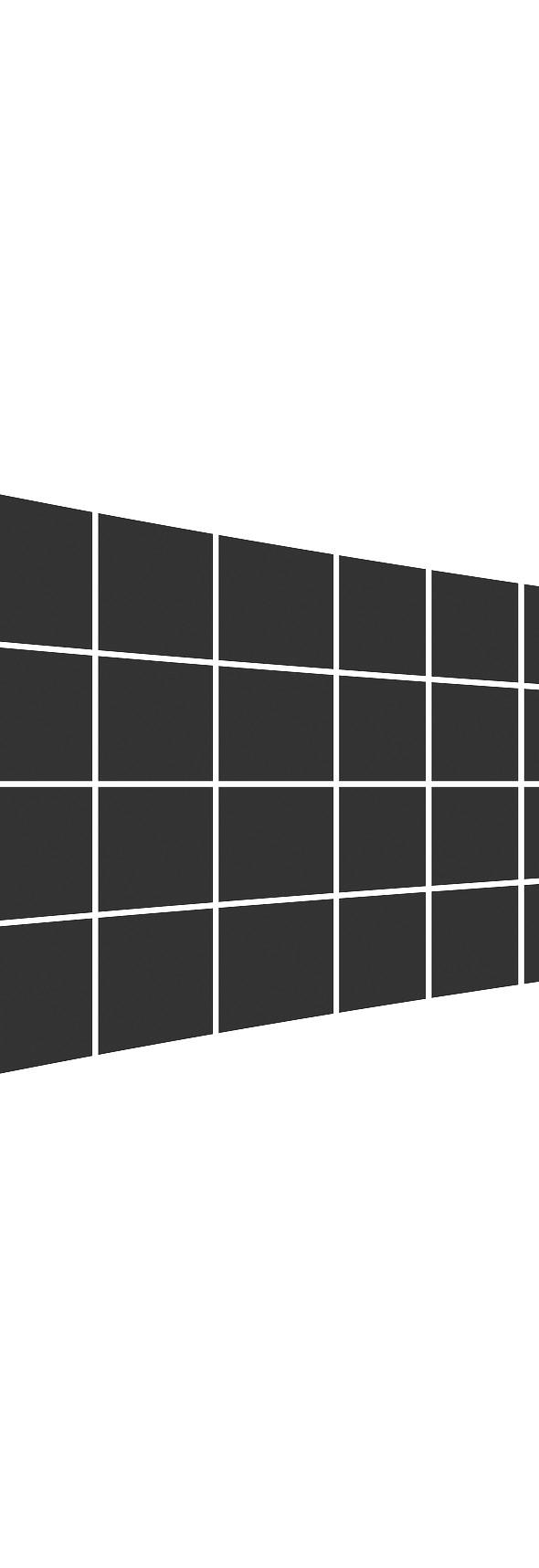


„BeReal“ heißt auf Deutsch „sei echt“, und dieser Anspruch zieht. Seit 2020 ist die vom französischen Programmierer Alexis Barreyat entwickelte App verfügbar, in den vergangenen Monaten hob sie ab. Insgesamt wurde die App 28 Millionen Mal heruntergeladen, der Großteil im letzten halben Jahr.
Vielleicht ist BeReal ein weiterer schnell verglühender Stern im gigantischen Social-Media-Universum. Ein kurzlebiger Hype, der entsteht, weil die App ein unbefriedigtes Bedürfnis der vielen erfüllt? In unsicheren Zeiten schafft BeReal mit einem kurzen täglichen Ritual nicht nur Verlässlichkeit, sondern auch Verbundenheit, indem man die Aufgabe zeitgleich macht und die Ergebnisse teilt. Man muss schnell sein, und das jeden Tag zu einem anderen Zeitpunkt. Ein Nervenkitzel, der Kreativität verlangt. Und all das verschwindet wieder.
Seit 20 Jahren gibt es im Internet soziale Netzwerke. Friendster startete 2002 und gilt als erste erfolgreiche Plattform, die es erlaubte, ein Profil zu erstellen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Freundeslisten und Gruppen imitieren das „echte“ Sozialleben. 2004 folgte Facebook, 2006 der Kurznachrichtendienst Twitter, 2010 die Fotoplattform Instagram (Face-
book, heute Meta, kau e es 2012), 2011 der Videodienst Snapchat, 2018 die chinesische Musikvideo-App TikTok. Viele andere Namen sind mittlerweile längst vergessen. Friendster wurde 2015 eingestellt, Google+ 2019, das deutsche StudiVZ im März 2022. Die Plattformen, die überleben, verändern sich ständig – und zwar nicht, weil sie unbedingt etwas Neues erfinden, sondern indem sie geschickt andere SocialMedia-Kanäle kopieren. Facebook übernahm Hashtags von Twitter, Twitter seine „Spaces“, in denen Audio-Konversationen geführt werden können, von der Audio-App Clubhouse, Instagram die „Stories“, also die verschwindenden Inhalte, von Snapchat.
Nachahmung ist die höchste Form der Anerkennung, heißt es o . Nutzerinnen und Nutzer sehen das allerdings gerne anders. Wieso gehen solche Veränderungen so o mit Protest einher? Warum gibt gerade jetzt TikTok den Ton an? Und welches Erbe hinterlassen kurzlebige Hypes? Aus dem Kommen, Gehen und Wandel der sozialen Netzwerke in den vergangenen zwei Jahrzehnten lässt sich einiges lernen – über deren Funktionsweisen, über unsere Bedürfnisse als Menschen und über die Macht des Marktes.
„Make Instagram Instagram Again“, „Macht Instagram wieder zu Instagram“, fordert die Petition auf Change.org. Und weiter: „Hör auf, zu versuchen, TikTok zu sein, ich will nur süße Fotos meiner Freunde sehen. Herzlichst, alle.“ Über 300.000 Unterschri en hat die Mitte Juli von der 21-jährigen US-amerikanischen Fotografin Tati Bruening gestartete Petition mittlerweile. Unterzeichnet und geteilt haben sie nämlich auch Instagram-Schwergewichte wie das Model Kylie Jenner (366 Millionen Follower) und ihre Schwester, US-RealityTV-Star Kim Kardashian (329 Millionen Follower).
Die Hunderttausenden regt auf, dass Instagram zu sehr auf Videos setzt, wie es Konkurrent TikTok ausschließlich tut. Zudem hat Instagram seinen Algorithmus dahingehend verändert, dass man mehr Inhalte von Usern sieht, denen man nicht selbst folgt.
20 FALTER 34/22 MEDIEN
ANNA
ILLUSTRATION: OLIVER HOFMANN
ANALYSE:
GOLDENBERG
Auch das ist auf TikTok gang und gäbe –aber auf Instagram wollen die Nutzer nun einmal lieber nur Vertrautes sehen, die „süßen Fotos“ der Freunde eben, und weniger Videos von Influencern und anderen, die die Inhalte professionell herstellen.
Dass Neuerungen zunächst kritisch beäugt, ja abgelehnt werden, ist eine wohlbekannte menschliche Eigenscha . Die Psychologie spricht vom „Besitztumseffekt“. Studien belegen es: Menschen schreiben etwas, das sie bereits besitzen, mehr Wert zu als etwas Neuem, das gleich viel kostet. Das ist mit ein Grund, warum Veränderungen wie jene von Instagram zunächst einmal meist abgelehnt werden.
Doch mit der Zeit gewöhnt man sich auch an das Ungewohnte – ein Risiko, das Instagram allerdings nicht eingehen wollte. Die Plattform ruderte prompt zurück und „pausierte“ die getesteten Veränderungen.


„Der Protest demonstriert eine Logik der Plattformen“, sagt Johannes Paßmann. „Die sozialen Netzwerke haben einander immer beeinflusst, und es gab dagegen auch häufig Protest – wenn es Gruppen gab, denen die Plattformen etwas bedeuten.“ Paßmann ist Juniorprofessor für Geschichte und Theorie sozialer Medien an der Ruhr-Universität Bochum.

Auch ihm ist in den letzten Jahren die „TikTokisierung“ der sozialen Medien aufgefallen. Sie beschreibt das Phänomen, dass Funktionen der chinesischen Videoplattform TikTok von anderen Plattformen übernommen werden.
Kein Wunder, schließlich ist TikTok, die App für kreative Videoclips und Musikplaybackvideos, gerade erfolgreicher als alle anderen, und zwar vor allem bei der begehrten Zielgruppe der Jungen. Die erste Milliarde Nutzer hatte es in der Häl e der Zeit Facebooks beisammen, in Österreich nutzen es mehr als zwei Drittel der Jugendlichen täglich, und es werden immer mehr: Im Vorjahr waren es noch 57 Prozent.
Ist das meist nur wenige Sekunden kurze TikTok-Video vorbei, schlägt der Algorithmus das nächste vor. Und das macht er dermaßen gut, dass der durchschnittliche US-amerikanische Nutzer 50 Prozent länger auf TikTok verbringt als auf Instagram. Diese Verweildauer ist die harte Währung der sozialen Medien.
„TikTok hat die Personalisierung sehr gut hinbekommen“, sagt die Social-Media-Expertin Ingrid Brodnig. Man sieht, was man sehen will. Was der Algorithmus kreiert, ist die magische Serendipität, also das Erlebnis, etwas Interessantes zu finden, ohne danach gesucht zu haben. Somit befriedigt der Algorithmus die menschliche Neugier ebenso wie das Bedürfnis, aus dem schier unendlichen Meer der Online-Inhalte das Beste herauszufischen.
Und noch ein Bedürfnis erfüllt TikTok: Für die Generation Z, also die ab Mitte der 1990er Geborenen, ersetzt TikTok den Fernseher. Nachmittags sitzt kaum noch jemand vor der Glotze und zappt durch die Kanäle. Die Berieselung liefern die sozialen Medien am Smartphone. „Es gibt eine Sehnsucht nach der Restauration alter Medienverhältnisse“, drückt es der Medienwissenscha ler Paßmann aus. Der Durchschnittsuser postet immer weniger selbst, sondern bleibt, um zu schauen.
Bewegen muss man dabei nicht einmal mehr den Daumen. TikTok macht es besonders einfach: Musste man auf Facebook noch selbst durch den Newsfeed, also den Nachrichtenstrom, auf dem die Inhalte der Freunde zu sehen waren, scrollen, springt TikTok automatisch zum nächsten Video (eine Funktion, die es sich übrigens von Youtube abgeschaut hat).
Die Videos füllen zudem den gesamten Bildschirm des Smartphones; man taucht also total ein und sieht nicht, was als Nächstes kommt. Auch das ist ein Unterschied zum klassischen Newsfeed, auf dem meist die Ränder des vorigen und nächsten Posts zu sehen sind. (Der Newsfeed tauchte zuerst auf Twitter auf, wurde zunächst von Facebook und später von Instagram kopiert.)
Der Friedhof der sozialen Netzwerke füllt sich. Erst im März diesen Jahres ging die deutsche Plattform StudiVZ endgültig offline. 2005 gegründet, hatte es Ende 2009 stolze 6,2 Millionen User. Doch der zeitgleich wachsende Konkurrent Facebook grub ihm das Wasser ab. Mitschuld daran ist der Netzwerkeffekt, der darin besteht, dass die Plattform für den einzelnen User umso attraktiver ist, je mehr Mitglieder sie hat. Je größer sie also ist, desto schneller wächst sie auch. Wir wollen dort sein, wo alle sind. Facebook wurde zum digitalen Telefonbuch.
Das heißt aber nicht, dass vom Friedhof der sozialen Netzwerke nicht immer wieder Untote entfleuchen. So erging es beispiels-
»Es gab Zweifel, ob neben dem Riesen Facebook noch etwas au ommen kann. TikTok hat bewiesen, dass es möglich ist
INGRID BRODNIG
Alles kopiert?
Die ursprüngliche TweetLänge von 160 Zeichen

wurde von der 140 Zeichen langen SMS inspiriert, die auf die typische Postkartenlänge zurückgeht



weise Clubhouse. Im Lockdown-Winter vor anderthalb Jahren explodierten die Downloadzahlen der App, die rein audiobasierte Konversationen in verschiedenen „Räumen“ ermöglichte. 600.000 User hatte sie im Jänner 2021, zehn Millionen waren es – laut Eigenangaben der App – zwei Monate später. Menschen aus der ganzen Welt loggten sich ein, um sich selbst und den anderen beim Reden zuzuhören. Im Juni war der Hype vorbei. Man dur e sich zum Plaudern schließlich wieder persönlich treffen. Befruchtet hatte Clubhouse in der kurzen Zeit immerhin die Innovationsabteilung von Twitter, das im Mai 2021 seine „Spaces“ eröffnete, also Räume, die so funktionierten wie in der App. „Selbst wenn die Plattformen verschwinden, geht nicht alles verloren“, sagt der Medienwissenscha ler Paßmann. Ihr Erbe lebt weiter – als Kopie.
Eine natürliche Evolution der Innovationen also, die einigen Funktionen ein ewiges Leben beschert? Doch die Realität ist weniger romantisch. Der Markt bestimmt. Die Dominanz von Meta, dem Konzern, zu dem neben Facebook und Instagram auch der Messagingdienst Whatsapp gehört, macht es für andere Dienste schwer, sich langfristig zu behaupten.
Immer wieder versuchten es Konkurrenten. Als Facebook Mitte 2014 seine Klarnamenpflicht durchdrückte und Nutzer löschte, die sich nicht daran hielten, verzeichnete das soziale Netzwerk Ello im September 2014 einige Tage rund 30.000 Registrierungen pro Stunde. Doch das Interesse an der datenschutzfreundlichen Alternative hielt nicht lange. Eine Woche später war nur noch jeder Fün e aktiv; das Design von Ello war zu wenig intuitiv und auf dem Konkurrenten Facebook schlicht viel mehr los. Mittlerweile hat sich Ello in eine Plattform verwandelt, die Kreativschaffende mit Agenturen und Marken zusammenbringt. Immerhin.
ler Johannes Paßmann:
„Lange Zeit gab es Zweifel, ob neben dem Riesen Facebook noch etwas au ommen kann“, sagt die Social-Media-Expertin Ingrid Brodnig. „TikTok hat bewiesen, dass es möglich ist.“ Doch der Preis ist hoch. Das Mutterunternehmen von TikTok ist in China – und unterwir sich den dort geltenden Gesetzen. Es zensiert Informationen zu Hongkong und Taiwan und soll auch die Inhalte von queeren Personen im Algorithmus benachteiligt haben. Dazu kommt, dass es „Master-Admins“ geben soll, die US-amerikanische Nutzer ausspionieren. Es bleibt zu hoffen, dass das keine Funktionen sind, die sich andere Netzwerke abschauen. F
Mitarbeit: Nina Brnada, Magdalena Riedl
FALTER 34/22 21
FOTO: PRIVAT
scha
„Die sozialen Netzwerke haben einander immer beeinfl usst“
Auf dem Weg zu mehr Gleichheit
Thomas Piketty ist der wohl einflussreichste Ökonom der Gegenwart. „Eine kurze Geschichte der Gleichheit“ erscheint am 25. August
REZENSION: MARKUS MARTERBAUER
Er schreibt millionenfach verkaufte Beststeller und in den Fachjournalen der Wirtschaftswissenschaft; er schlägt konkrete gesellschaftsverändernde Politik vor und revolutioniert die Verteilungsforschung.
Thomas Pikettys „Eine kurze Geschichte der Gleichheit“ ist eine Kurzfassung seiner Standardwerke „Kapital im 21. Jahrhundert“ (2014) und „Kapital und Ideologie“ (2020), aber sie ist mehr als das. Beschrieben die beiden Bücher Ursachen und ideologische Absicherung der Vermögenskonzentration in den Händen weniger, geht es nun um die Entwicklung zu mehr Gleichheit.
Dabei zeigt sich Piketty als „radikaler Optimist“ (Falter 11/2020). Er sieht die Geschichte trotz aller Ungerechtigkeiten als Entwicklung hin zu mehr Gleichheit. Etwa wenn es um die Dekonzentration von Vermögen geht: Der Anteil des reichsten Prozents am Vermögen lag in Frankreich von 1780 bis zum Vorabend des Ersten Weltkriegs bei mehr als der Hälfte. Bis 1980 wurde er unter 20 Prozent gedrückt, als Folge von Kriegen und Wirtschaftskrisen, aber auch des Aufstiegs der Arbeiterklasse, die in politischen Kämpfen mehr Gleichheit und Freiheit errang. Ungleichheit ist nicht die Folge ökonomischer Gesetze, sondern ideologischer Weichenstellungen und menschlicher Entscheidungen. Um Entscheidungsmacht zu erlangen, muss man aus der Vergangenheit lernen.
Militärische Übermacht, Kolonialismus, Sklaverei, Protektionismus und Ausbeutung des Planeten waren bestimmend für die europäische Dominanz auf den Weltmärkten und den Reichtum der europäischen Eliten. Soziale Kämpfe in Europa und den Kolonien beendeten diese Dominanz und reduzierten den wirtschaftlichen und poli-
tischen Einfluss der Vermögenden. Diese Erfolge waren ambivalent, selbst nach der Abschaffung der Sklaverei wurden nicht die Opfer, sondern die britischen und französischen Sklavenhalter für ihren Verlust entschädigt. Die Spuren der Sklaverei prägen noch heute Vermögensverhältnisse und Gesellschaften. Reparationsleistungen sind offen, die Frage von Gleichheit und Demokratie stellt sich in den weltwirtschaftlichen Beziehungen. Schweden zählte noch 1900 zu den ungleichsten Gesellschaften Europas. Das extreme Zensuswahlrecht gab einem vermögenden Fabriks- oder Grundbesitzer bei Gemeindewahlen mehr als die Hälfte aller Stimmen. Die staatlichen Institutionen dienten den Interessen der Reichen. Doch innerhalb weniger Jahrzehnte wurde Schweden zu einer der egalitärsten Gesellschaften der Welt. Sozialdemokratie und Gewerkschaften erkämpften Demokratie, Wohlfahrtsstaat und progressive Steuern. Der Staat wurde zum Instrument der arbeitenden Bevölkerung.
Progressive Steuern auf Einkommen, Vermögen und Erbschaften sowie der Ausbau des Wohlfahrtsstaates sind Kernelemente in Pikettys Projekt eines „demokratischen, ökologischen und multikulturellen Sozialismus“. Ein fortschrittliches Projekt braucht auch eine internationale Vision, die die Macht multinationaler Konzerne und der Milliardäre weltweit begrenzt. Piketty entwirft postkoloniale Reparationen, ein globales Vermögensregister und neue Formen internationaler Demokratie, um der globalisierten Wirtschaft Leitplanken zu geben. Covid- und Energiekrise verschärfen Ungleichheit. Während Arme und die arbeitende Bevölkerung verlieren, wachsen Übergewinne der Konzerne und Überreichtum der Milliardäre. Vielleicht ist das ein entscheidender Moment, in dem auf Basis der Erfahrungen vergangener Verteilungskämpfe sozialer Fortschritt erreichbar ist.
Thomas Piketty: Eine kurze Geschichte der Gleichheit. C.H. Beck, 264 S., € 25,–

Gelesen Bücher, kurz besprochen
Kapital und Ideologie
Piketty geht in seiner Analyse den Rechtfertigungen von Ungleichheit nach. Mit „Ideologie“ beschreibt er Ideen, Diskurse, Normen-, Institutionensysteme und Machtverhältnisse. Vermögensverteilung und Ungleichheit sind das Ergebnis der herrschenden Ideologie. Er analysiert die europäischen Feudalgesellschaften, Kolonialreiche, Ölmonarchien am Persischen Golf und hyperkapitalistische Gesellschaften von heute, ohne dabei in Defätismus zu verfallen. Denn auch die globale, neoliberale Ungleichheit ist instabil. Die Konzentration von Vermögen und Einkommen ist außer Kontrolle geraten. Die politische „Heiligsprechung von Eigentum, Stabilität und Ungleichheit“ und deren Rechtfertigung durch „Leistung“ stehen im Gegensatz zu den täglichen Erfahrungen der Menschen. Ein Gegenmodell muss auf gleichberechtigten Zugang zu Gesundheit, Bildung, sozialer Sicherheit und demokratischer Beteiligung sowie eine Beschränkung des Privateigentums durch Steuern, öffentliches Eigentum und eine „Grunderbschaft“ für alle setzen. MARKUS MARTERBAUER
Thomas Piketty: Kapital und Ideologie. C.H. Beck, 1312 S., € 39,95
Wieder gelesen
Bücher, entstaubt

Kapital im 21. Jahrhundert
Die besprochenen Bücher können Sie über Ihre Buchhandlung, aber auch über unsere Website erwerben, die alle je im Falter erschienenen Rezensionen bringt www.falter.at/ rezensionen
Der Erfolg von Thomas Pikettys „Kapital im 21. Jahrhundert“ wurde zum Ausgangspunkt einer „Piketty-Schule der Ökonomie“ und der World Inequality Database (WID), der umfassendsten Sammlung von Daten zur Verteilung von Einkommen und Vermögen. Er beschreibt die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, als das reichste Prozent der Haushalte mehr als die Hälfte des Vermögens besaß und nur durch Erbschaft und Heirat reich werden konnte. Die im Buch dargestellte Formel r > g zierte sogar TShirts: Die Rendite auf Vermögen ist größer als das Wachstum der Wirtschaft, die Vermögenskonzentration verstärkt sich. Piketty bietet Abhilfe: progressive Steuern auf Erbschaften und Vermögen. MM
Thomas Piketty: Das Kapital im 21. Jahrhundert. C.H. Beck, 816 S., € 29,95
22 FALTER 34/22 POLITISCHES BUCH
FEUILLETON Neue Bücher 30
Der Rezensent Markus Marterbauer ist Chefökonom der Arbeiterkammer
Daniel Jokeschs „Krisencomic“ Folge 22: Im Neusiedler See
NACHSPIEL DIE
DER WOCHE
Schon wieder hat Europa ein Wochenende lang in Schnappatmung verbracht. Nein, es war nicht nur verfilztes Haar, das die Gemüter erhitzte. Sondern, Sie wissen es, eine tanzende Regierungschefin.
Sanna Marin, Sozialdemokratin, ist mit 36 Jahren die jüngste Ministerpräsidentin Finnlands und derzeit Zielscheibe giftiger Empörungspfeile. Mehrere Videos kursieren online, in denen sie ausgelassen ihre Hüften schwingt. Rechtspopulistische Gegner sprachen von Regierungsunfähigkeit ob möglicher Intoxikation. Daraufhin posteten Politikerinnen und Frauen aus dem Ausland neue Videos, um sich tänzerisch zu solidarisieren.

Sanna Marin ist bekannt für ihren Hang zum Feiern. Im Juli ging ein Foto von ihr in Biker-Outfit auf einem Rockfestival um die Welt, 2021 tanzte sie eine
Nacht lang mit einer Corona-positiven Freundin. Wie so oft ist die öffentliche Meinung in zwei Lager gespalten. Verantwortungslos finden das die einen, lässig die anderen. Letztere können sich wohl einfühlen ins urbane Partyleben. Der Rest hätte mit Exzess auch kein Problem. Aber eben nur dann, wenn es um die Männerdomäne der Polit-Clowns geht.
Für die gehört es nämlich zum guten Ton, möglichst politisch inkorrekt und angetschechert unterwegs zu sein. Man denke an Pussy-Grabber Donald Trump oder Boris Johnson, den Corona-Partytiger. Beide wurden als Anti-EstablishmentKandidaten ins Amt gewählt – gerade weil sie nicht dem klassischen Politikertypus entsprechen. Nun ist es aber eine junge Frau, die nicht nur mit ihren Beratern hinterm Schreibtisch sitzt, sondern auch auf den Putz haut, lustvoll und wild. „Volksnah“ hieße das bei einem Mann. Was soll man sagen? Rock on, Sanna!
Feuilleton-Redakteurin Lina Paulitsch bewundert Sanna Marins Körperspannung
FEUILL ETON

GUT BÖSE JENSEITS
Baby beißt Schlange! Richtig gehört: Im türkischen Bingöl wurde eine Zweijährige von einem 50 Zentimeter langen Kriechtier gebissen, das Kind schnappte zurück. Manche Dinge kann man auch ohne Mama und Papa regeln.

Als ein 16-jähriger Welser im Ortsgebiet mit 100 Sachen von der Polizei erwischt wurde, deutete er auf seinen Vater: „Er hat gesagt, ich soll mal reinsteigen.“ Tipp für eine g’sunde éducation toxique: Gas geben, Bua!
Basketballlegende Dennis Rodman möchte seiner Kollegin Brittney Griner helfen, in Russland freizukommen, wo sie wegen Drogen einsitzt. Der Rodman, der Nordkoreas Kim Jong-un die Atombombe ausreden wollte?

FALTER 34/22 23 FOTOS: APA/HELGA HAPP, APA/DPA/ALEXANDER KŠRNER, APA/AFP/MARK RALSTON
EINE
die Wahl gestellt, zu jammern oder hochstaplerisch aufzutreten, ist mir das Hochstaplerische allemal lieber. „Mich interessiert die vor sich hin taumelnde Welt“, Seite 24
KULTURKRITIK
DIE FINNISCHE REGIERUNGSCHEFIN TANZTE UND SORGTE FÜR EMPÖRUNG.
VERTEIDIGUNG Vor
„Mich interessiert die vor sich hintaumelnde Welt“
INTERVIEW: SEBASTIAN FASTHUBER
N orbert Gstrein legt mit „Vier Tage, drei Nächte“ den Schlusspunkt einer Trilogie über dubiose Figuren Tiroler Herkunft vor. In den Büchern klingen von Rassismus bis MeToo viele große Themen an, allerdings werden sie nicht auf zeitgeistige Art abgehandelt, sondern in gefinkelt fiktionalisierter Form.
Zunächst als Raststätten-Gespräch am Weg in den Urlaub von Hamburg nach Kroatien geplant, wurde das Interview schließlich über einen Vormittag schriftlich mit hin- und herfliegenden Mails geführt.
Falter: Herr Gstrein, Sie fühlen sich beim Schreiben auf dünnem Eis wohler als auf abgesichertem Gebiet. Ihre letzten Romane werden angetrieben von der Idee: Wie weit kann ich mich vorwagen?
Norbert Gstrein: Schiere Provokation wäre uninteressant. Eher geht es mir darum, Geschichten zu erzählen, die unverkennbar heutige Geschichten sind, inspiriert von heutigen Diskursen, ohne denen am Ende verhaftet zu sein. Die Welt ist komplizierter geworden, und noch komplizierter scheint geworden zu sein, wie wir darüber sprechen. Das ist der Raum, der mich interessiert.
Eine dieser komplizierten Fragen ist: Wer darf noch worüber sprechen? In Ihrem neuen Roman schreibt ein Mann eine Abrechnung über eine Beziehung, die Frau darauf die Replik „Was der kleine Klaus nicht erzählt hat“. Als weißer Mann gehöre er „fast schon automatisch der Vergangenheit an“, heißt es.
Gstrein: Das ist der Befund einer Romanfigur, und das ist auch der Eindruck, den man gewinnen kann, wenn man die Scharmützel beobachtet, die auf dem Markt der Öffentlichkeit bei bestimmten Themen geführt werden. Gleichzeitig ist das nicht etwas, woran ich selbst glaube. Das mag mit meinem Alter und mit meiner Pigmentierung zu tun haben. Das hat vor allem aber auch damit zu tun, dass ich mir eine Diskussion wünsche, in der es um das bessere Argument geht und nicht um diese oder jene Eigenschaft, die man dem jeweiligen Sprecher, der jeweiligen Sprecherin zuweisen kann. „Was der kleine Klaus nicht erzählt hat“ ist im Übrigen ein Zitat. Mario Vargas Llosas erste Frau Julia hat auf dessen Roman „Tante Julia und der Kunstschreiber“ mit einem eigenen Buch reagiert. Es heißt „Was der kleine Mario nicht erzählt hat“.
Ihre weibliche Protagonistin arbeitet an einem Roman mit dem Titel „Drei Arten, ein Rassist zu sein“. Es geht um eine Dreiecksgeschichte mit einem schwarzen Liebhaber. Welchen Shitstorm würde dieses Buch bekommen?
Gstrein: Das ist ein Roman, den ich selbst nicht schreiben wollte. Deshalb habe ich ihn einer meiner Figuren untergeschoben. Mich hat dabei interessiert, ob man sich nicht allzu leicht und schnell auf der sicheren Seite wähnt und ob nicht Situationen denkbar sind, in denen selbst Figuren
aus einem aufgeklärten Milieu sich plötzlich selbst als rassistisch wahrnehmen müssen. Ein Hintergrund ist dabei auch meine anhaltende Lektüre des US-Schriftstellers William Faulkner. In seinem Werk gibt es eine schreckliche Reihe von furchtbar agierenden Figuren, aber selbst die wenigen, die man als positiv und aufgeklärt empfinden kann, agieren nicht mehr so, wenn die Sexualität ins Spiel kommt. Niemand ist dann mehr zurechnungsfähig und schon gar nicht berechenbar.
„Vier Tage, drei Nächte“ erzählt eine Dreiecksgeschichte. Der Erzähler übernimmt die abgelegten Liebhaber seiner Halbschwester. Was hat Sie an dieser alten Konstellation gereizt?
Gstrein: Diese beiden Halbgeschwister sind eine einzige Figur, wenigstens in meinem Kopf. Das muss verwirrend klingen, aber so empfinde ich es, deshalb auch ihr inzestuöses oder halb-inzestuöses Verhältnis zueinander. Es ist für mich hauptsächlich eine Perspektivenfrage gewesen: Ein Mann schreibt über eine Frau und ist ihr sehr nahe. Bei der Frage, wie nahe er ist,
Norbert Gstrein, geboren 1961 in Mils bei Imst, studierte Mathematik in Innsbruck und Stanford. Er debütierte 1988 mit der Erzählung „Einer“. Es folgten Romane wie „Die englischen Jahre“ oder „Das Handwerk des Tötens“. Zuletzt erschienen in schneller Folge „Als ich jung war“, „Der zweite Jakob“ und nun „Vier Tage, drei Nächte“. 2021 erhielt Gstrein den ThomasMann-Preis. Er lebt mit Frau und Tochter in Hamburg
Gstrein: Wenn Sie Trilogie sagen, denke ich sofort an einen Schuber, in dem die drei Bände stecken, in allerfeinster Ausstattung, Leineneinband, fadengeheftet, Lesebändchen. Das hört sich nach einer untergegangenen Welt an, aber natürlich lassen sich zwischen den Romanen deutliche Bezüge herstellen. Das beginnt mit der Herkunft und mit den Schauplätzen. Alle drei Erzähler, so unterschiedlich sie sind, stammen aus Tiroler Hoteliersfamilien, und in allen Romanen gibt es einen für die Geschichte ganz wesentlichen amerikanischen Strang. Was die Bücher aber am meisten verbindet, sind wohl die Ich-Erzähler. Ihnen haftet allen etwas Unheimliches an. Sie erzählen Dinge von sich, die sie vielleicht besser ungesagt ließen, und scheinen manchmal sogar damit zu kokettieren. Wenn ich nicht Angst hätte, dann gleich wieder für 100 Jahre nicht aus der katholischen Ecke hervorgelassen zu werden, würde ich sogar von einem Beichtzwang reden. Bekenntniszwang reicht aber wohl auch.
Welche Rolle spielt Tirol in Ihren Büchern? Die Figuren versuchen sich zu distanzieren, aber sie kommen von ihrer Herkunft in den Bergen nicht los, weil sie vom Geld der Hotelierseltern abhängen.
hat sich mir immer mehr diese Konstellation aufgedrängt, Bruder und Schwester, die vielleicht auch noch mehr sind als Bruder und Schwester.
Sie haben einmal gesagt: „Wenn ich nicht aufpasse, werden meine Figuren immer verrückter.“
Gstrein: Die beiden nehmen sich für mich immer noch vergleichsweise harmlos aus, obwohl der Bruder schon eine sehr problematische Figur ist. Er könnte ein später Nachfahre von Quentin Compson aus Faulkners Romanen „Schall und Wahn“ und „Absalom, Absalom!“ sein. Der sieht sich auch als Verteidiger der „sexuellen Unversehrtheit“ seiner Schwester und kann sich leichter einen Inzest mit ihr vorstellen, als dass er die Vorstellung zulässt, sie könnte etwas mit einem anderen Mann haben. Noch einmal bedacht, ist er schon ziemlich verrückt, dieser Bruder, in der Art, wie er mit den Liebhabern seiner Schwester umgeht, und die Schwester steht ihm in ihrer eigenen Verrücktheit kaum nach.
Ihre letzten drei Romane lassen sich als Trilogie begreifen. Wie hängen die Bücher zusammen?
Gstrein: Das sind wohl halb ins Schizophrene gehende Abspaltungen meiner eigenen Person. Es gibt in ihnen beides, Anziehung, zumal was die eigene Kindheit betrifft, und Abstoßung oder sogar Abgestoßensein. Irgendwo müssen die ja herkommen, und wenn sie sich allein mit ihrer Herkunft unter einen Verdacht stellen, soll mir das nur recht sein. Dann kann ich sie um so tiefer in diesen Verdacht hineinerzählen, aber eben nur in den Verdacht, und weil ich schon lange nichts mehr davon halte, wenn jemand ein Problem entdeckt und kritisiert und sich nicht gleichzeitig als möglichen Teil dieses Problems begreift, brauchen sie diese Verstrickung. Sie sind ihrer Herkunft nicht entkommen und werden im Zweifelsfall durch das Geld, das auch Schwarzgeld sein kann, auf sie zurückgebunden.
Es gibt eine fantastische Szene, in der die großen Tiroler Hoteliers als „ihre eigenen Tschuschen“ den Müll wegbringen. Am Mistplatz trinken sie ihr erstes Bier. Der Vater ist selig, „unbelästigt von Gästen in den üblen Gerüchen und dem von der Halde heraufdringenden Baggerlärm stehen zu können, als wäre das die einzige Möglichkeit für ihn, noch etwas zu finden, das sich echt und wahrhaftig anfühle“. Nicht erfunden, oder?
Gstrein: Diese Geschichte, in einer weniger zugespitzten Form, hat mir ein Freund erzählt, und natürlich bin ich bei unserem Treffen sofort auf die Toilette gegangen, um sie aufzuschreiben. Ich glaube im Übrigen nicht sehr an Erfindungen und bin eher abgeschreckt, wenn ich in einem Roman den Eindruck bekomme, etwas sei reine Erfindung. Das hat meistens mit der Form zu tun und damit, dass etwas nicht gut erzählt ist. Ich glaube eher daran, dass man in
24 FALTER 34/22 FEUILLETON
Der österreichische Autor Norbert Gstrein stellt einen neuen Roman vor. Ein Gespräch über Rassismus, Lockdown-Literatur, Tiroler Hoteliers, Bob Dylan und Bonnie Tyler
»Ich versuche den Eindruck zu erwecken, als hätte ich Geld und als würde es nie ein Problem sein
NORBERT GSTREIN
der Fiktion noch auf die winzigsten Erfahrungskeime vertrauen sollte. Welche Blüten die dann treiben, ist eine ganz andere Frage, und man muss nicht verblüfft, sondern eher glücklich sein, wenn ein Apfelbaum am Ende Kirschen trägt.
Amerika ist Ihnen ewiger Sehnsuchtsort. In den 1980ern haben Sie ein Jahr in Stanford studiert. Waren Sie nie versucht, dauerhaft rüberzuziehen?
Gstrein: Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich zum ersten Mal wieder vor dem Haus in Palo Alto gestanden bin, in dem ich damals gewohnt habe, 2590 Webster Street.
Dort habe ich mein erstes Buch geschrieben, und merkwürdigerweise hat mich ein Riesenschrecken erfasst, als ich nach so vielen Jahren wieder zu meinen damaligen Fenstern hinaufgeschaut habe und alles rundherum unverändert schien. Ich hätte genauso gut noch dahinter sitzen und an der Schreibmaschine herumhacken können, die ich aus Österreich mitgebracht hatte, und etwas daran hat dieses Entsetzen ausgelöst. Denn ich hätte mich andererseits auch noch irgendwo auf dem Campus herumtreiben können, hätte ich mir nicht eingebildet, ich müsste jeden Nachmittag nachhause gehen, um ein paar Zeilen zu schreiben,

und die Vorstellung, ich würde mich immer noch dort auf dem Campus herumtreiben, ist eine schöne Vorstellung geblieben. Es ist also eher ein amerikanisches Phantasma als ein amerikanisches Leben, das für mich möglich gewesen wäre, aber natürlich kann ich auch da nicht anders, als damit zu kokettieren.
Glauben Sie an die Zukunft des Romans? Gstrein: Lassen Sie es mich pathetisch sagen: Ich nehme das Abendlicht deutlich wahr, und das bedeutet, dass es bald Nacht
FEUILLETON FALTER 34/22 25
FOTO: OLIVER WOLF
Fortsetzung nächste Seite
Norbert Gstrein: „In der Fiktion sollte man noch auf die winzigsten Erfahrungskeime vertrauen“
Fortsetzung
von Seite 25
werden könnte, aber gleichzeitig gibt es nichts Schöneres als dieses Abendlicht, und jeder Roman, der etwas taugt, kann immer noch die Kraft haben, die Nacht ein wenig hinauszuzögern. Weniger pathetisch gesagt: Es gibt eine sehr enge Beziehung zwischen einer durch Romane begreifbaren Welt und einer menschlichen Welt. Mein Glaube an die Zukunft des Romans ist manchmal ein bisschen angekränkelt, aber wenn ich am Ende nicht doch daran glauben würde, würde es mir schwerfallen, überhaupt an eine Zukunft zu glauben.
Wie sieht es mit Hochgefühlen beim Schreiben aus? In den letzten Jahren scheint Buch um Buch aus Ihnen herauszupurzeln.
Gstrein: Na ja, es sind ja viele Jahre Vorarbeiten. Elias Canetti hat in seiner Autobiografie sein Leben so dargestellt, als hätte er schon als Säugling gewusst, dass er später der Elias Canetti werden würde, den wir kennen. Wenn Sie sich mich also als einen anderen Säugling vorstellen, der in seiner Tiroler Bergwelt vom ersten Atemzug an mit nichts anderem beschäftigt war als mit dem Norbert-Gstrein-Werden, dann ist das schon eine sehr gründliche Recherche. Aber im Ernst: Ich mag diese Selbstdarstellungen von Autoren nicht, die sagen, sie hätten zehn Jahre lang im Schweiße ihres Angesichts gerungen, um ihre Bücher damit aufzuwerten. Zehn Jahre gerungen, und dann ist es doch ein schlechtes Buch geworden.
Die Kindheit in einem Tiroler Hotelbetrieb wirkt auch in Norbert Gstreins neuem Roman nach
Da sind mir kürzere Zeiträume schon lieber, ohne dass ich irgendwelche falschen Zugeständnisse mache.
Vorangestellt ist dem Roman ein Zitat aus einem Song der Popsängerin Bonnie Tyler. Kann ein Vier-Minuten-Song manches besser ausdrücken als ein 300-Seiten-Werk? Gstrein: Alles zu seiner Zeit und alles an seinem Ort. Ich war nicht glücklich über Bob Dylan als Nobelpreisträger, im Gegenteil, es hat für mich ausgesehen wie eine momentane Selbstaufgabe der Literatur. Andererseits hat das Zitat von Bonnie Tyler natürlich eine wichtige Funktion in meinem Roman: „Every now and then I fall apart.“ Die Schwester hat für ihren Bruder eine Aufnahme gemacht, sie selbst singt den Song, und für ihn hat die Zeile eher etwas Triumphales als etwas, das er fürchten müsste.
Manche werden das Buch als LockdownRoman lesen.
Gstrein: Das kann passieren, aber ich hoffe nicht, dass mein Roman irgendwann in der dann wahrscheinlich viel zu langen Liste von Lockdown-Romanen auftaucht. Er spielt kurz vor Weihnachten 2020 und im letzten Kapitel im Sommer darauf, und natürlich gibt es dadurch Beobachtungen in ihm, die genau mit dieser Zeit zu tun haben, aber die Figuren des Romans begreifen Corona nicht als ihr Thema. Ich hätte Angst gehabt, wenn es für mich in diesem
Sinn ein Thema gewesen wäre, wie es in den von Ihnen so genannten LockdownRomanen wohl eines ist. Da stelle ich mir dann immer Autoren vor, die wenig erlebt haben und es gar nicht erwarten können, sich auf etwas zu stürzen, das ihnen die Wirklichkeit nun doch anliefert. Ich fürchte tatsächlich, die Verlage könnten es in naher Zukunft noch mit vielen Weltuntergangsromanen zu tun bekommen. Es war und ist schrecklich, was die Pandemie auf der Welt angerichtet hat, aber die Welt ist nicht untergegangen, und diese Untergangsfantasien und diese Untergangslust gibt es nur in den Köpfen von Autoren und natürlich auch Autorinnen. Eine untergehende Welt, die man vielleicht retten könnte, hat für sie mehr Gewicht als eine, die nur irgendwie vor sich hin taumelt, wie sie es in der Wirklichkeit tut. Diese vor sich hin taumelnde Welt interessiert mich.
Der alte Patriarch im Buch glaubt, mit Geld alles regeln zu können. Er ist schockiert, als er erfährt, wie hoch bzw. niedrig Literaturstipendien dotiert sind.
Gstrein: Wo Geld ist, wird in der deutschsprachigen Literatur allzu automatisch auch schnell einmal das Böse verortet. Natürlich ließe sich darüber erzählen, aber es müsste halt erzählt und nicht als ewig wahre Prämisse vorausgesetzt werden. Die Wahrheit ist eher, dass die meisten von uns Autoren ganz einfach keine Ahnung haben und zu faul zum Recherchieren sind. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der US-Schriftsteller Richard Ford in einem Interview einmal gesagt, er habe nichts gegen Geld, er schätze es sehr, seiner Frau manchmal etwas Schönes zum Anziehen kaufen zu können. Abgesehen davon, dass das nicht mehr ganz heutig klingt – können Sie sich vorstellen, dass ein deutschsprachiger Autor jemals so etwas gesagt hätte?
Nein. Wie ist Ihr Verhältnis zu Geld?
Gstrein: Ich habe keines, versuche gleichzeitig aber in allen Lebenslagen den Anschein zu erwecken, als hätte ich Geld und als würde es nie ein Problem geben. Das hat entschieden mit meiner eher kleinbürgerlichen als unternehmerischen Herkunft zu tun, und vor die Wahl gestellt, zu jammern oder hochstaplerisch aufzutreten, ist mir das Hochstaplerische allemal lieber. Der Vater im Roman sagt: „Was bekommt so ein Literaturstipendiat denn?“, durchaus verächtlich, und dem lässt sich nur mit Stärke begegnen. F
Vom Inzest bis zur Corona-Party: Norbert Gstreins Identitätsspiele
Fluid-sexuelle Figuren und Beziehungs-Talk bestimmen den neuen Gstrein-Roman. Wie in seinen letzten Büchern ist er nah an der Gegenwart dran, ohne sich in Zeitgeistigem zu verlieren. Es gibt im Hintergrund einen Tiroler Hoteliersvater, gleichzeitig Witzfigur und Sponsor der Geschwister, dessen legendäre Preseason-Sause Ende 2020 zur Corona-Party wird. Den Fall in die Tiefe, ins Existenzielle löst im Roman aber nicht die Pandemie aus, sondern der Blick in die eigenen Abgründe.
Ich-Erzähler Elias ist ein unzuverlässiger Berichterstatter, der gutherzig und bisweilen naiv rüberkommt, aber auch Hintergedanken hat. Das Schwarzweißdenken,
das so viele Romane heute auszeichnet, die klare Einteilung in Gut und Böse, die Figuren zu Pappkameraden macht, all das liegt Gstrein fern. Sein Held, wenn man ihn so nennen möchte, ist so widersprüchlich gestaltet, wie Menschen es eben sind.
„Vier Tage, drei Nächte“ hätte das Zeug zum Thriller, doch wäre es kein Gstrein-Roman, würde am Ende jemand einer Tat überführt. Stattdessen vertieft er sich in die Identitätsspiele und Selbstinszenierungen seiner beinahe inzestuösen Hauptfiguren.
Norbert Gstrein: Vier Tage, drei Nächte. Hanser, 352 S., € 26,80

Wenn es gefährlich wird, greift der Autor gern auf die Tiroler Bergwelt als Kulisse zurück. Hat Elias Matt, den amerikanischen Freund von Ines, bei ihrer Wanderung zu dritt absichtlich gestoßen? Und was ist mit dem jungen deutschen Touristen, der beim Skifahren tödlich verunglückt ist? Welche Rolle haben die Halbgeschwister damals gespielt?
Was kann man vom Leben der anderen wissen, was weiß man überhaupt von sich selbst? In makellosen, gern auch etwas weiter ausholenden Sätzen arbeitet sich Norbert Gstrein in seinen Büchern, immer neu ansetzend, an ähnlichen Fragen ab. Dass sein Schreibprogramm nicht langweilig wird, spricht für ihn.

26 FALTER 34/22 FEUILLETON
FOTO: CONTRAST/PICTUREDESK.COM
SEBASTIAN FASTHUBER
Es ist ein unerhörter Moment. Daemon Targaryen (Matt Smith), der jüngere Bruder von König Viserys (Paddy Considine), hat sich auf den Eisernen Thron gesetzt. Heimlich. Weil er das als Zweitgeborener gar nicht darf. Als er sich von Prinzessin Rhaenyra (Milly Alcock) dabei absichtlich erwischen lässt, weil er eigens für sie auf dem – aus den Schwertern gefallener Feinde und in Drachenfeuer geschmiedeten – Thron lungert, schenkt er der Erbin zum ersten Mal sein hämisches Lächeln. Mit diesem Mann bricht, so viel steht bereits in der ersten Episode von „House of the Dragon“ fest, ein neues Zeitalter an.
An wem die populärste TV-Serie des vergangenen Jahrzehnts nicht spurlos vorübergegangen ist, weiß aus „Game of Thrones“, was diese Provokation vorwegnimmt: Mord, Hochverrat, Eifersucht, Intrigen, Sex und – weil die Herrschaft des weißblonden Königsgeschlechts der Targaryens auf deren Macht beruht – Feuer speiende Dra-
Mord, Sex und Hochverrat
chen. Wer teuren Trash liebt, wird auch von „House of the Dragon“ von Beginn an begeistert sein.
In jeder anderen Serie und jedem Kinofilm wäre eine solche Szene mindestens lächerlich. Doch in „House of the Dragon“ ist das Gegenteil der Fall: Denn das Prequel des vor drei Jahren zu Ende gegangenen Fantasyepos „Game of Thrones“, das 200 Jahre später angesiedelt ist und in dem sich mit Daenerys Targaryen die letzte Nachfahrin des Hauses – leider, wir wissen es bereits – durch die Sieben Königslande kämpft, steht seinem Vorgänger in puncto Vordergründigkeit in nichts nach.
Acht Staffeln und 73 Episoden dauerte die Fernsehschlacht, ein ganzes Autorenteam erzählte acht Jahre lang hemmungslos dahin – zunächst nach der Bestseller-Vorlage von George R. R. Martin, später, weil der Autor mit dem Schreiben fürs Fernsehen nicht schnell genug vorankam, von eigenen Ideen befeuert. Mit „Game of Thrones“ gelang dem US-Sender HBO die erste Serie, an der anscheinend – vergleichbar mit Franchise-Filmreihen wie „Lord of the Rings“ und „Harry
Potter“ – kein Weg vorbeiführte und die zum tatsächlich globalen Phänomen avancierte. Es war die letzte große Serie vor dem Streamingboom, die man noch gefühlt als kollektives Erlebnis teilen konnte.
„House of the Dragon“ basiert auf Martins 2018 erschienenem Roman „Fire & Blood“ und ist nun Vorgeschichte, Fortsetzung und Wiedergutmachung zugleich: Die Vorgeschichte aus Westeros findet endlich im Fernsehen ihre Fortsetzung; und sie muss dem Branchenblatt Variety zufolge für 20 Millionen Dollar pro Folge jene Heerscharen von Fans wieder zufriedenstellen, die diverse Schlampigkeiten des Vorgängers – der Kaffeebecher von Daenerys nach der Schlacht von Winterfell! – nicht so einfach hinnehmen wollten. Wobei auch „House of the Dragon“, sobald die Charaktere einmal in Position gebracht und die Schauplätze etabliert sind, eine Tendenz zur unfreiwilligen Komik nicht abzusprechen ist.

Weshalb sich nach ein paar Streamingstunden weniger die Frage stellt, wie diese im Grunde ausbuchstabierte Geschichte weitergeht, sondern wie es

ihr gelingt, tatsächlich alles genau so aussehen und klingen zu lassen, wie man sich das vorstellt. Wie sie unzählige Motive aus dem Archiv der Mythologie schöpft und zum modernen Fernsehmärchen aufeinanderhäuft:
Ein gütiger König, der sich zwischen Frau und Kind entscheiden muss und der in seiner Freizeit an einer Steinburg bastelt; eine auf einem Drachen reitende Prinzessin, die sich ihrer Bestimmung nicht entziehen kann, bei der Liebesgefühle für einen edlen Ritter erwachen und die sich von der besten, weil einzigen Freundin verraten fühlt; ein grausamer Usurpator, der Wagenkarren voller verstümmelter Leichen zurücklässt. Soll heißen: Liebe, Zerstörung und Wahnsinn als pure Unterhaltung. Es geht also um alles und um nichts.
Irgendwann stehen Nichte und Onkel einander auf einer hässlich computergenerierten Steinbrücke gegenüber und streiten um ein Drachenei. Aber der Vertraute des Königs weiß, was hier gespielt wird: „This is a truly pathetic show.“ F

FEUILLETON FALTER 34/22 27
Jetzt auf Sky, zehn Episoden
„House of the Dragon“ erzählt die Vorgeschichte von „Game of Thrones“. Wer teuren Trash mag, wird begeistert sein
SERIENKRITIK:
MICHAEL PEKLER
Mit diesem Finsterling bricht ein neues Zeitalter an: Daemon Targaryen (Matt Smith) macht es sich auf dem Eisernen Thron gemütlich
GOT , J
DOWNLOAD now APPSTORE GOOGLEPLAY WHAT S HOT
FOTO: HBO
U K A T
The Cure sangen 1980: „Boys Don’t Cry“. Doch stimmt der Befund, dass Männer ihre Gefühle nicht offen zeigen können, heute noch? Ari Oehl findet: Ja. Er beginnt sein neues Album deshalb mit einer gesungenen Entschuldigung: „Und es tut mir leid. Es tut mir leid, dass du wegen mir geweint hast.“

So klingt der Prolog zu einer Platte, die von Tod, Krankheit und Abschieden handelt, aber nicht schlechte Laune macht, sondern Trost spenden will. Das Album heißt „Keine Blumen“ und mutet wie eine Umarmung in dem Moment an, in dem man sie gerade besonders nötig hat.
Die Lieder formulieren gleichzeitig poetische Antworten auf die vielen Fragen, die Oehls vierjähriger Sohn an ihn richtet. „Ich kann ihm keine heile Welt anbieten“, sagt der Musiker bedauernd. „Stattdessen bemühe ich mich, ihm zu erklären, warum die Welt schwierig ist und warum Menschen sterben.“
Die Karriere des in Wien lebenden Salzburgers startete 2019 ebenso vielversprechend wie ungewöhnlich. Der deutsche Rapper Casper war im Internet auf das Stück „Keramik“ gestoßen und erklärte es via Social Media zu seinem Song des Jahres. Das Lied zeigte bereits alle Insignien dessen, was die Musik Oehls ausmacht: eigenwillig lyrische Texte zu sanftmütigen elektronischen Beats und eingängigen Melodien.
Herbert Grönemeyer war bereits vorher hellhörig geworden und hatte Oehl für sein Label Grönland Records unter Vertrag genommen. Wohlgemerkt zu einem Zeitpunkt, als der Name selbst in Wien kaum jemandem ein Begriff war. Bald ging es
mit dem deutschen Superstar auf Tour. So kam es, dass die Band bei ihrem erst dritten Konzert vor 20.000 Menschen auftrat.
Damals war Oehl ein Duo, bestehend aus dem Sänger und Songwriter Ari Oehl und dem aus Island stammenden Multiinstrumentalisten Hjörtur Hjörleifsson. Das Debütalbum „Über Nacht“ erschien 2020. Im Februar 2020 absolvierte man noch eine erste HeadlinerTour durch Deutschland und spielte in Berlin, München und Hamburg vor vollen Häusern. Dann zog die Pandemie den Stecker.

Zum Falter-Interview erscheint der Sänger allein. Heute ist Oehl sein Soloprojekt. In den Lockdowns begann er selbst Musik zu produzieren, und der gemeinsame Kreativprozess mit seinem Kompagnon geriet ins Stocken. Hjörleifsson arbeitet mittlerweile verstärkt fürs Theater. Die Freundschaft ist geblieben, anstatt zusammen Konzerte zu spielen, treffen sich die beiden nun zu Spieleabenden.
Das charakterisiert Ari Oehl gut. Er vertieft sich lieber eine Nacht lang in „Die Siedler von Catan“, als in Clubs zu gehen, ist keine Rampensau, sondern eine zurückgezogen vor sich hin werkelnde Arbeitsbiene. Speziell an seinen Texten, die schon mal Goethe oder Rilke zitieren, feilt er sehr lang.
Der bekennende Morgenmensch ist dann produktiv, wenn der Rest der Welt Ruhe gibt und noch keine Mails eintrudeln. Tagwache ist oft schon um fünf Uhr („Ich kenne Bauern, das ist nicht so früh!“). Vom Bett geht es direkt an den Schreibtisch. Erster Kaffee nicht vor neun. Kreativ gearbeitet wird bis Mittag. So geht das bei ihm jeden Tag.
Jammern auf
Geregelte Abläufe und Rituale sind für Oehl als AspergerAutist wichtig, erklärt er. „Die Notwendigkeit von Struktur führt dazu, dass ich eigentlich nie auf Urlaub fahre, da ich nach drei Tagen meistens Fieber bekomme, was ultramühsam ist, wenn man gerade in Paris ist oder Portugal. Mir fehlen dann sämtliche Alltagsrituale, allen voran mein Computer und das Musikmachen in den ersten Morgenstunden.“
Touren dagegen geht gut. Zumindest dann, wenn es geregelte Tagesabläufe gibt. Am besten bis ins Detail: „Ich muss wissen, wer wann das Auto fährt, wer fürs Tanken verantwortlich ist und wer sich um die Zimmerschlüssel fürs Hotel kümmert. Das mag kontrollfreakmäßig rüberkommen, ist für mich aber außerhalb von zuhause sehr wichtig, um eine innere Ruhe und mein Funktionieren zu gewährleisten.“
Soziale Interaktion sei für ihn extrem fordernd, erzählt Oehl, der seit seiner Kindheit mit Ticks kämpft. Im konzentrierten 1:1Gespräch in einem ruhigen Raum merkt man das gar nicht. Schwierig wird es, wenn in Lokalen im Hintergrund Musik läuft oder rundherum Gespräche stattfinden, die ihn ablenken.
Er versucht, Asperger aber auch positive Seiten abzugewinnen: „Mentale Erschöpfung kenne ich zum Beispiel kaum. Ich bin bei Projekten oft der Erste, der kommt, und der Letzte, der geht, weil mir das Gefühl für viele Dinge wie etwa Hunger in solchen Momenten fehlt.“
Der Sohn einer Lehrerin und eines Kriminologen hätte, wenn es nach seinem Vater gegangen wäre, auf die Handelsakademie gehen sollen. „Dass ich ein musisches
28 FALTER 34/22 FEUILLETON
Oehl: Keine Blumen (Grönland) Live: Wuk, 29.9. Ari Oehl hätte für seinen Sohn gern eine heile Welt
PORTRÄT: SEBASTIAN FASTHUBER FOTOS: HERIBERT CORN Österreichische Popmusik: Oehl und Sophia Blenda versuchen, der komplizierten Gegenwart in ihren Liedern mit
hohem Niveau
Poesie beizukommen. Das klingt bisweilen düster und traurig, aber auch erhebend schön. Nuscheln ist erlaubt
Gymnasium mit Literaturzweig besuchen durfte, hat mich gerettet“, sagt er. Dort entdeckt er sein Faible für Literatur.
Seine Lieder beziehen ihren Reiz aus dem Kontrast zwischen der für Popsongs ungewöhnlich hohen Sprache und den sehr lässig federnden Grooves. Wo seine Kunst zur Schwermut neigt, sehnt Oehl sich eigentlich nach Leichtigkeit. Er träumt davon, Songs zu schreiben, „die einem nicht den ganzen Tag nachhängen“. Doch das wäre keine Oehl-Musik mehr.
Seine selbstironische Schmäh-Kurzrezension von „Keine Blumen“ lautet: „Wenn man gemein sein will, jammere ich 13 Lieder lang.“ Nicht ganz falsch, aber das Gejammer klingt verdammt gut.
Die schärfsten Kritiker von Sophia Blenda sind ihre Eltern. Grundsätzlich seien sie schon sehr stolz, sagt die Tochter. Nur: „Sie verstehen nicht, warum meine Musik immer so düster sein muss. Dabei kann düstere Musik heilsam sein. Wenn es einem schlecht geht, kann man in Lieder reingehen und fühlt sich in dem Gefühl nicht mehr allein.“

Sophia Blenda heißt eigentlich Sophie Löw und ist in einem niederösterreichischen Dorf fernab von jeder Subkultur aufgewachsen. Es gab in ihrer Umgebung nicht einmal einen langhaarigen Gitarristen, der ihr Nirvana vorgespielt hätte. Also sang sie im Kirchenchor und imitierte zuhause im Kinderzimmer Stars wie R’n’BStimme Christina Aguilera oder PoppunkSängerin Avril Lavigne.
Dass es mehr als Mainstream gibt, entdeckte sie erst bei ihrem Umzug nach Wien. Dann ging alles sehr schnell, und Blenda
avancierte als Sängerin der jungen Postpunk-Band Culk zu einer der spannendsten Stimmen der heimischen Musikszene.
Weil sie früh einen eigenen Stil kultivierte: einen fast schon deklamierenden Sprechgesang mit einer guten Dosis Pathos, aber auch nicht zu viel. Ähnlich wie Oehl sticht ihre Musik durch die eigenwilligen, gern etwas komplexeren Texte heraus. Die erste Culk-Single „Begierde/Scham“ etwa basierte auf Löws Lektüre von Simone de Beauvoirs Roman „Die Mandarins von Paris“. Schnell jubelte auch das deutsche Feuilleton über die Wiener Band.
Nach zwei Alben mit Culk fand die Frontfrau, dass es Zeit für etwas anderes war. Zum einen wollte sie ihrem Instrument, dem Klavier, mehr Raum geben. Und es geht ihr auch darum, sich als Solokünstlerin zu beweisen. Selbst in aufgeklärten Zirkeln sei es keineswegs selbstverständlich, als Musikerin ernst oder überhaupt nur wahrgenommen zu werden, erzählt Löw.

„Immer wieder wird angenommen, dass ich als Sängerin die Lieder nicht selbst schreibe. Solche Aussagen kommen zwar nur von einzelnen Leuten, sind deshalb aber nicht weniger störend.“
Das hat sie angestachelt, auf ihrem Soloalbum vom Schreiben bis zu Sounddetails so gut wie alles selbst zu machen. Anfangs hatte Löw nur ein paar Texte, die sie für nicht für die Band geeignet hielt, weil sie näher an ihr als Person waren. Dann entstand immer mehr Material, und schließlich begann sie auch selbst zu produzieren. Die Artworks und die Konzepte zu den Videoclips stammen ebenfalls von ihr.
Die Musik bewegt sich im Grenzgebiet zwischen Popsong, Kunstlied und Chanson und ist mit ihrem Fokus auf Klavier, Streicher und Elektronik doch wie aus einem Guss. Sie klingt über weite Strecken schwer, getragen, es gibt aber auch Momente der Katharsis. Löw will nicht runterziehen. Ihre Platte soll einen Safe Space bilden, in den man sich vor Unbill und Ängsten flüchten kann.
Die Texte sind vielschichtig lyrisch, dafür setzt sie gern plakative Titel darüber. „BH“ heißt ein Song, der ausgehend vom Büstenhalter Machtverhältnisse verhandelt. Der Albumtitel „Die neue Heiterkeit“ schießt überhaupt den Vogel ab. Denn heiter klingt die Musik nun wirklich nicht.
Löw meint es jedoch keineswegs ironisch: „Ein wiederkehrendes Thema auf dem Album sind Ängste. Sie sind etwas Konstruiertes, das nur im Kopf ist. Wenn man so will, sind Ängste eine Entscheidung. Ebenso gut kann man sich für Heiterkeit entscheiden.“
Für ihre Generation, die sich oft komplett erschlagen fühle, wäre das eine gute Entscheidung, so Löw. Das heißt nicht, dass alle dauerlächelnd durch die Straßen laufen müssen.
Als sie ihren Gesangsstil entwickelte, traf sie eine andere wichtige Entscheidung: beim Singen zu nuscheln. „Manche Leute stören sich daran“, sagt sie. „Dabei mache ich das absichtlich.“ So klingt die harte deutsche Sprache in ihren Liedern ein wenig geschmeidiger. Löw empfiehlt undeutliche Aussprache auch als Theatralikbremse: „Wenn man mit Pathos arbeitet, stellt sich die Frage, wie man es dosiert. Nuscheln mildert es ab.“
FEUILLETON FALTER 34/22 29
F
Die
17.9.
Sophia Blenda:
neue Heiterkeit (Siluh) Live: Volkstheater,
Sophia Blenda begreift ihre Musik als Safe Space
Buch der Stunde
Das Porträt der Neandertaler als Blick in den Spiegel
Es gibt sehr viele populärwissenschaftliche Bücher über Neandertaler und davon sind viele gut. „Der verkannte Mensch“ der britischen Archäologin und Wissenschaftskommunikatorin Rebecca Wragg Sykes aber ragt heraus. Zwei Jahre nach Erscheinen des englischen Originals wurden bereits über 20 Übersetzungen publiziert, jetzt auch auf Deutsch. Was ist so gut an dem Buch? Es ist umfassend und einfühlsam, jeweils im besten Sinne.

Neue Platten
Ohren auf Dance Music
Sykes: Der verkannte Mensch. Ein neuer Blick auf Leben, Liebe und Kunst der Neandertaler.
Goldmann, 512 S., € 24,70
Wragg Sykes resümiert gekonnt alles, was wir derzeit über die Neandertaler wissen. Alles. Sie durchstreift jeden Lebensbereich: die Jagd, Ernährung, Geburt, Kindheit, soziale Dynamik, Kunst oder der Umgang mit dem Tod.
Ja, das ist manchmal ein wenig sehr detailliert, etwa wenn sie die ungeheure Komplexität der Steinwerkzeuge beschreibt, deren Herstellung und ständige „Wartung“ (Schleifen). Aber egal. Angesichts ihrer verblüffenden handwerklichen Fähigkeiten entwickelt man enormen Respekt für die Neandertaler – und für die Archäologen, die diese steinernen Überbleibsel interpretieren.
Mit am faszinierendsten sind die Erkenntnisse, die sich durch neue Technologien gewinnen lassen. Das Kollagen ihrer Zähne verrät uns, was die Neandertaler aßen und dass sie mindestens ein Jahr lang stillten.
Die Mikroanalyse der Höhlenböden, der Feuerstellen und „Wohnbereiche“, Rußschicht um Rußschicht, erlaubt Einblicke wie ein prähistorisches TV. Neandertaler schliefen wohl auf Fellen und trennten ihren Abfall.
Die DNA-Analysen stellen infrage, inwiefern man vom „Aussterben“ der Neandertaler sprechen kann. „Wir“ haben uns bekanntlich mit ihnen vermischt. Aber eben nicht nur einmal, sondern unzählige Male im Laufe von Tausenden von Jahren. Rebecca Wragg Sykes’ Erzählton ist sachlich und doch durchdrungen von einer tiefen Sympathie für diesen „verkannten Menschen“. Ihr Porträt des Homo neanderthalensis wird zum Blick in den Spiegel.
OLIVER HOCHADEL
Pop
Fireboy DML: Playboy

Ob elektronische Musik oder R’n’B: In Afrika entstanden zuletzt ganz neuartige Ausprägungen verschiedenster Genres und Stile. Besonders beliebt und erfolgreich ist der sehr poppige AfrobeatsSound, zu dessen bekanntesten Vertretern Fireboy DML zählt. Der Ex-Chorknabe mit dem LoverboyImage singt bevorzugt über Amouröses. Die Songs des längst weltweit agierenden Nigerianers bringen Balladenstimmung und effizient swingende Grooves lässig unter einen Hut. (YBNL Nation) SF
Pop
Valerie June: Under Cover

Die aus Memphis stammende Sängerin mischt Folk mit Country, Blues und Gospel. Ihre nasal klingende Sopranstimme sorgt sofort für Aufmerksamkeit. Hier singt Valerie June ihre Lieblingslieder von Künstlern, die sie in der Entwicklung als Songwriterin beeinflusst haben – Nick Drake („Pink Moon“), Nick Cave („Into My Arms“) oder R’n’BMann Frank Ocean („Godspeed“). Die Aneignung gelingt, Gefühlstiefe und Leichtigkeit gehen bei June Hand in Hand. (Fantasy) SF
Klassik
Jonathan Tetelman: Arias

Jonathan Tetelman, chilenisch-US-amerikanischer Tenor und ehemaliger New Yorker DJ, hat sich seiner musikalischen Wurzeln besonnen und sein Debüt veröffentlicht: 16 Arien von Verdi bis Giordano, von Mascagni bis Puccini, von Bizet bis Massenet. In ihrer Vielfalt ist die Stimme eine echte Entdeckung – lyrisch und romantisch, heroisch und dramatisch. Zweimal ist Tetelman zudem im Duett mit der fantastischen litauischen Sopranistin Vida Miknevičiūtė zu hören. Hinreißend! (DG) MDA
Neue Bücher Human-Animal-Studies und Zeitgeschichte
Können Kaninchen Kunst? Müssen wir Mücken das Recht auf Leben zusprechen? Braucht es ein Urheberrecht für Menschenaffen-Selfies? „Kommt Strolchi in den Himmel?“ Und ist Robbenschutz Kulturimperalismus? „Das unterschätzte Tier“ regt zum Weiterdenken an: Es liefert Fakten dazu, „was wir heute über Tiere wissen und im Umgang mit ihnen besser machen müssen“.
Nach 20 Jahren im Dienst gilt die Band Hot Chip als sichere Bank zwischen Synthiepop und Dance Music. Das Quartett um die beiden Sänger Alexis Taylor und Joe Goddard kennt die Popgeschichte bis in die entlegensten Winkel. Derartiges Auskennertum gebiert oft blutleere Musik, aber Hot Chips Erdung im Club und ihr Hang zur Melancholie sorgt zuverlässig dafür, dass ihre Songs Beine wie Herz ansprechen. Sie sind die Pet Shop Boys des neuen Jahrtausends.

Otfried Preußler wurde 1923 in Reichenberg, heute Liberec, Tschechien, geboren. Sein Vater war Heimatforscher, seine Großmutter eine begnadete Geschichtenerzählerin. Das Schreiben wird dem Autor des „Hotzenplotz“ also in die Wiege gelegt. Als die Familie 1945 aus dem sudetendeutschen Gebiet vertrieben wird, befindet sich Otfried Preußler als Kriegsgefangener in der Sowjetunion, wo er fünf Jahre verbringt.
FELICE GALLÉ
Norbert Sachser, Verhaltensbiologe an der Universität Münster, hat Kollegen aus Disziplinen wie Biologie, Philosophie, Recht, Geschichte und Religionswissenschaft versammelt: Wissenschaft für die Praxis, für ein besseres Miteinander über Artgrenzen hinweg, für mehr Gerechtigkeit. „Bereits jetzt hat die Revolution des Tierbildes zu einem Bewusstseinswandel in unserer Gesellschaft geführt. Nun muss sie auch zu einem verbesserten Umgang mit den Tieren führen!“
Mit zum Teil erst 2021 in Moskauer Militärarchiven aufgefundenen Dokumenten, Briefen und literarischen Texten rekonstruiert Carsten Gansel dessen frühe Jahre bis zur Veröffentlichung des Meisterwerks „Krabat“ im Jahr 1971. Dieses interpretierte Preußler als den Versuch, „einer als böse oder fragwürdig erkannten Macht gegenüber seine Freiheit zurückzugewinnen“. Ein atemberaubendes Stück Zeitgeschichte! KIRSTIN
BREITENFELLNER
Auf ihrem achten Studioalbum „Freakout/Release“ (Domino) versuchen sie ein bisschen was Neues. Die Übung lautet: Funk. Im Opener „Down“ gelingt sie gut. Wobei Hot Chip über genug Selbsteinschätzung verfügen, sich nicht zu gerieren, als wären sie James Browns Begleitband. Stattdessen haben sie eine selbstironische Nummer namens „Hard To Be Funky“ im Programm, in der sie über den Zusammenhang zwischen Funkiness und Sexyness räsonieren. Eine Platte ohne Schwach- und auch ohne große Höhepunkte. Disco für die mittleren Jahre.
Bewunderung muss keine Einbahnstraße sein. Noah Lennox alias Panda Bear von den Neo-Psychedelikern Animal Collective liebte die in den 1980ern aktiven Spacemen 3. Deren Kopf Peter Kember alias Sonic Boom outete sich seinerseits später als Fan von Lennox’ Combo. Auf ihrem Album „Reset “ (Domino) huldigen Panda Bear & Sonic Boom nun gemeinsam der Musik der Sixties –etwa den Beach Boys in ihren ausgeflippten, drogengeschwängerten Momenten. Schön.
Norbert Sachser (Hg.): Das unterschätzte Tier. Rowohlt Taschenbuchverlag, 224 S., € 14,40

Carsten Gansel: Kind einer schwierigen Zeit. Otfried Preußlers frühe Jahre. Galiani, 558 S., € 28,95

Unter dem Namen Au Suisse machen der House-Revivalist Morgan Geist und Kelley Polar, ein Geigenvirtuose mit Disco-Faible, gemeinsame Sache. „Au Suisse“ (City Slang) setzt auf klare Linien. Es ist die Verwirklichung eines Designertraums, wie Electropop zu klingen hat – makellos und sehr kühl.
SEBASTIAN FASTHUBER
30 FALTER 34/22 BÜCHER : PLATTEN FOTO: MATILDA HILL-JENKINS
Rebecca Wragg
Die britische Band Hot Chip: Auch melancholische Nerds wollen tanzen
Es ist schwer, funky zu sein, wenn man sich nicht sexy fühlt
ALLE AUF DIESER SEITE BESPROCHENEN BÜCHER UND CDS ERHALTEN SIE UNTER FALTERSHOP.AT
„Antisemitismus geht nicht mehr von den Nazis aus“
Das Leben des Industriellen Erwin Javor wurde vom Holocaust geprägt. Nun mischt er sich mit dem Thinktank Mena-Watch in die Debatte über Antisemitismus ein – und stößt auf Kritik
BEGEGNUNG: MATTHIAS DUSINI

D ort drüben, am Rudolfsplatz im ersten Bezirk, sei das Geschäft der Eltern gewesen, sagt der Unternehmer Erwin Javor. Und da am Salzgries das Kaffeehaus, in dem sich in den 1950ern die Ostjuden versammelten, die wie der Vater aus dem Schtetl kamen und jiddisch sprachen. Hier trafen sie auf die kultivierten Juden aus Budapest, Javors Mutter stammte aus so einer Familie. Es wurde viel gestritten: Polen gegen Rumänen, Schtetl contra Stadt, Orthodoxe grenzten sich von Zionisten und Kommunisten ab. Alle Gruppen waren durch die Shoah verbunden und dem, was Javor „die jüdische Sache“ nennt.
Wenn derzeit vom Kampf gegen den Judenhass die Rede ist, dann fällt rasch der Name Javor. Er finanziert Mena-Watch, der sich als „unabhängiger Nahost-Thinktank“ definiert und immer aufzeigt, wenn etwas Auffälliges passiert. Wer ist der Mann, der so offensiv die Öffentlichkeit sucht?
„Der Antisemitismus geht nicht mehr von den Nazis aus. Meine religiösen Freunde werden von jungen muslimischen Zuwanderern angegriffen“, sagt Javor. Solche Sätze lösen bei manchen Unbehagen aus, denn sie könnten auch von einem rechten Politiker stammen. Die FPÖ etwa blendet ihre Wurzeln in der NS-Ideologie aus und hängt den Antisemitismus den arabischen Migranten um.
Javor wehrt sich dagegen, ins rechte Eck gestellt zu werden. Zu sehr ist seine Biografie mit den NS-Verbrechen und deren Leugnung nach dem Krieg verwachsen. Die Kronen Zeitung etwa hetzte gegen einen Freund der Familie, den Publizisten Simon Wiesenthal (1908–2005), der seit den 1950er-Jahren Kriegsverbrecher vor Gericht bringen wollte. Der Einzelkämpfer rechnete stets mit Gewalt: „Wenn Wiesenthal uns besucht hat, trug er immer einen Revolver bei sich.“

Beide Elternteile hatten fast alle Verwandten im Holocaust verloren, darunter auch die Ehepartner. Die Mutter brachte eine Tochter mit in die zweite Ehe, Javors Halbschwester Eva. 1950 flüchtete die Familie aus Budapest nach Wien und wartete auf ein Visum für die USA. Eva schloss sich einer zionistischen Jugendorganisation an, die ein sozialistisches Palästina als Zuflucht versprach. „Für sie war der Zionismus die Hoffnung auf ein lebenswertes Leben“, sagt Javor.
Die Eltern wollten die 14-Jährige nicht ziehen lassen. Von den Kriegserlebnissen traumatisiert, stürzte sich Eva aus dem Fenster und war tot. „Ich begriff erst viel später, was das bedeutete. Es blieb eine Verzweiflung innerhalb der Familie, die ich für den Rest meines Lebens spüren würde“, schreibt Javor in seiner Autobiografie.
Die Javors bauten sich in Wien im Stoffhandel eine Existenz auf. Nach dem Jiddischen des Vaters und der Muttersprache Ungarisch musste Erwin Javor sich nun an das Deutsche gewöhnen. 1968 übernahm Erwin, damals noch Soziologie- und Jusstudent, eine kleine Metallfirma und entwickelte sie zu einem internationalen Stahl-
konzern mit 700 Mitarbeitern. Für die meisten Ostjuden war Wien keine Heimat, sondern eine Zwischenstation, so auch für Javor. Heute pendelt er zwischen Wien und Tel Aviv, wo er ein Begegnungszentrum errichtet hat.
Im Jahr 2000 gründete Javor Nu, ein jüdisches Magazin für Politik und Kultur. Er wollte Stimmen zu Wort kommen lassen, die den Kurs der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) kritisierten. Auch er selbst meldete sich pointiert zu Wort: „Für wie dumm hält man eigentlich die Mitglieder unserer Gemeinde?“, fragte er in einem Kommentar zu den Finanzen der IKG. Bereits im Nu fiel Javor durch eine radikal israelfreundliche Position auf. Als er sich mit dem Mitgründer und heutigen ÖVP-Abgeordneten Martin Engelberg überwarf, verließ Javor die Redaktion.
Der Rushdie-Attentäter und sein „direkter Kontakt“ zum Iran. Die Holocaust-Relativierung des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas. Ein offener Brief Javors an die Schriftstellerin Eva Menasse. Das sind die aktuellen Themen von MenaWatch. Im Jahr 2011 gründete Javor den Thinktank aus Frust über die verzerrte Berichterstattung über den Nahen Osten. Zu oft war von den palästinensischen, nur selten von israelischen Opfern die Rede. Die von dem Mäzen finanzierte Redaktion hat zwölf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sechs davon fest angestellt.

Erwin Javor kam 1947 in Budapest zur Welt. Er baute den Frankstahl-Konzern auf und gründete jüdische Publikationen. Javor lebt in Wien und Tel Aviv und sponsert den FK Austria. Seine Autobiografie „Ich bin ein Zebra“ ist im Amalthea Verlag erschienen www.mena-watch.com
Der Vorwurf der Einseitigkeit, den Javor den Mainstream-Medien macht, fällt auf Mena-Watch zurück. Hier publizieren nicht nur Politologen, sondern auch die Sängerin Sandra Kreisler, die in einem Podcast meinungsstark die Geschichte des „jüdischen Kernlands“ erzählt. Bei Mena-Watch handelt es sich weniger um ein wissenschaftliches Forum als um eine aktivistische Plattform, die die Interessen des israelischen Staates verteidigt.
In der Mena-Watch-Logik gelten auch jene, die von einer Apartheidpolitik, also der diskriminierenden Behandlung der Palästinenser sprechen, als Antisemiten. Die Wiener Schriftstellerin Eva Menasse kritisiert einen maßlosen Anti-Antisemitismus, einen Jagdtrieb, der sich auch gegen jüdische Intellektuelle richte. Sie meint damit auch die Kampagnen des „unsäglichen“ Mena-Watch.
Falter-Debatte Antisemitismus
In Falter 31/22 erschien ein Überblick über den Documenta-Skandal, in Falter 32/22 eine Einschätzung Eva Menasses und in Falter 33/22 eine Erwiderung von Natan Sznaider
„Die Linken glauben immer, sie hätten die Wahrheit gepachtet“, kontert Javor, der sich selbst als liberalen Atheisten bezeichnet. Er erinnert an die 60er-Jahre, als Israel als Büttel des US-Imperialismus dämonisiert wurde. Und an den ehemaligen Bundeskanzler Bruno Kreisky (1911–1990), der selbst Jude war, aber Simon Wiesenthal diffamierte und ehemalige Nazis in die Regierung holte. „Ich habe immer die SPÖ gewählt, nur nicht, als Kreisky Kanzler war.“ Und was ist für Javor die jüdische Sache: „Das ist einfach – überleben.“ F
FEUILLETON FALTER 34/22 31
FOTO: CHRISTOPHER MAVRI č
Eva-Maria Hagen, 1934–2022
Die Schauspielerin und Sängerin EvaMaria Hagen, Mutter von Punkstar Nina Hagen, starb im Alter von 87 Jahren in Hamburg. Hagen war ein Star der DDR-Kultur, bevor sie aus Protest gegen das kommunistische Regime in den Westen ging. Ihre Schauspielkarriere begann Anfang der 50er-Jahre im Berliner Ensemble, wo Bertolt Brecht Regie führte. Einem größeren Publikum wurde sie dann durch die Filmkomödie „Vergesst mir meine Traudel nicht“ (1957) bekannt, es folgten zahlreiche Kino- und TVProduktionen. Hagen führte eine Beziehung mit dem oppositionellen Liedermacher Wolf Biermann, der 1976 wegen politischen Widerstands ausgebürgert wurde. Als sie dagegen protestierte, wurde die Künstlerin mit einem Berufsverbot belegt. Die Tochter Catharina (später: Nina) Hagen, Jg. 1955, stammt aus der Ehe mit dem Schriftsteller Hans Oliva-Hagen.

#MeToo-Prozess gewonnen
Der ehemalige Intendant der Berliner Volksbühne, Klaus Dörr, 60, war ein Symbol der #MeToo-Bewegung. Nun gewann er, berichtet die Berliner Zeitung, einen Gerichtsprozess gegen die Tageszeitung taz, die 2021 schwere Vorwürfe gegen den Kulturmanager – Machtmissbrauch und „sexualisierte Grenzüberschreitungen“ –erhoben hatte. In der Folge trat Dörr von seinem Amt zurück, beteuerte aber seine Unschuld. Wie die Berliner Zeitung ausführt, beruhten die Sexismusvorwürfe auf Handlungen wie der Verwendung von Begriffen wie „Maus“ oder Handküssen zur Begrüßung. SMS nach Feierabend seien als Machtmissbrauch interpretiert worden. Der Volksbühnen-Skandal hat-
te eine enorme Resonanz, da er den patriarchalen Grundzug des Theaterbetriebs vermeintlich aufzudecken schien. Dörrs Karriere war ruiniert; er erhielt nie wieder ein Jobangebot.
Ralf Schenk, 1956 –2022

Er galt als das Gedächtnis des ostdeutschen Films. Der aus Thüringen stammende Filmhistoriker Ralf Schenk studierte Journalistik in Leipzig, schon damals war er dem Kino verfallen und leitete einen Jugendfilmklub. Nach 1990 leistete er Pionierarbeit bei der Auseinandersetzung mit der Geschichte der DEFA (Deutsche Film AG) und zeichnete als Autor
von Standardwerken wie „Das zweite Leben der Filmstadt Babelsberg“ (1994) oder der Monografie „Regie: Frank Beyer“ (1995) verantwortlich. Von 2012 bis 2020 machte er sich als Vorstand der DEFA-Stiftung um die Digitalisierung des Filmerbes verdient und war u.a. Mitherausgeber des Kompendiums „Sie“ (2019) über die Regisseurinnen der DDR. Am 17. August ist Ralf Schenk nach kurzer schwerer Krankheit verstorben.
Wolfgang Petersen, 1941–2022 Jahrelang hatte er sich TV-Routinen bereits zu eigen gemacht, ehe 1977 sein Name dank der „Tatort“-Folge „Reifezeugnis“ (mit Nastassja Kinski) bekannt wurde: Wolfgang Petersen, gebürtig aus der ostfriesischen Stadt Emden, Student der extrem politisierten Filmhochschule Berlin, war von Beginn seiner Regiekarriere an vor allem an Formen populären Erzählens interessiert. Mit dem Weltkriegsdrama „Das Boot“, das 1983 in sechs Kategorien für den Oscar nominiert war, gelang ihm der Sprung nach Hollywood. Petersens dort realisierte Filme waren handwerklich weit weniger anspruchsvolle Starvehikel. Umso sicherer machten sie Kasse. Der Clint-Eastwood-Thriller „In the Line of Fire“ (1993) spielte als erster Film eines deutschen Regisseurs über 100 Millionen Dollar ein. Hits mit Dustin Hoffman („Outbreak“) und Harrison Ford („Air Force One“) folgten, danach mit „Troja“ ein künstlerisches und mit „Poseidon“ ein kommerzielles Debakel. Zum unwürdigen Schlusspunkt seiner Laufbahn wurde die deutsche Gaunerkomödie „Vier gegen die Bank“ (2016). Am 12. August ist Wolfgang Petersen in Los Angeles einer Krebserkrankung erlegen.
Welt im Zitat Fehlleistungsschau
Kahlenpiste
Er ist das beliebteste österreichische Bergfotomotiv auf Instagram: der Dachstein. Platz zwei im InstaRanking belegt mit 15.967 Beiträgen der Arlberg. Auch Platz acht, die Planai, und Platz neun, der Kahlenberg, zeigen, dass vor allem Skigebiete im Ranking vertreten sind.
Aus derstandard.at
Gästetank

Mit der Ungewissheit, ob im Winter noch genügend Gast zum Heizen von Wohnungen und Häusern vorhanden sein wird, schießen auch die Preise von Brennholz und Pellets in die Höhe, und Betrüger machen gute Geschäfte.
Aus derstandard.at

Spitze Kugel
Polizei erschießt mit Messer bewaffneten 16-Jährigen.
Aus yahoo!
Sperrrrstunde!
Immer mehr deutsche Städte gehen gegen die Dauerbeschallung vor. Bis zu 5000 Euro Strafe drohen etwa Tübingern, die nach 22 Uhr noch Musik hören.
Aus dem Falter
Prof. Dr. Isegrim
„Die Verordnung war eine wichtige Maßnahme, auch wenn damit das Problem nicht ausreichend gelöst ist. Experten sagen uns ständig, man kann den Wolf mit Abschlüssen eh nicht mehr ausrotten.“
Aus dem Kurier
Mit den Waffen einer Frau Hund von ÖVP-Bürgermeisterin mit Schrotflinte erschossen.
Aus Heute
Dramatischer Spielverlauf
Es ist ein menschliches und politisches Drama, das die FPÖ jetzt einholt. Samstagnacht musste Hans-Jörg Jenewein, einstiger FPÖMandatar und enger Vertrauter von Herbert Kickl, mit der Rettung in ein Spiel gebracht werden.
Aus Heute
Kühler Fridiger
Ich habe mir Peter Goedels in jeder Hinsicht coolen Schwarzweiß-Ostsee-Western „Hinter den Elbbrücken“ über einen heimwehkranken Fernfahrer und Häuslbauer angesehen. 82 sehr schöne und bewegende Minuten im formidabel fridigerösen Filmmuseum.
Aus dem Falter
Für gedruckte Zitate erhalten Einsender ein Geschenk aus dem Falter Verlag (an wiz@falter.at)
Nüchtern betrachtet
Klaus Nüchtern ist derzeit auf Urlaub. Die Kolumnen als Buch: faltershop.at
32 FALTER 34/22 FEUILLETON
Meldungen Kultur kurz
Tex Rubinowitz Die falbe Seite
Von Berlin nach Hollywood: Filmemacher Wolfgang Petersen
FOTOS: APA/DPA/STEPHANIE PILICK, AFP/TIZIANA FABI
Vom DDR-Star zur Regimekritikerin: die Schauspielerin Eva-Maria Hagen
DER NEUSTIFTER
KIRTAG ZEIGT DAS SCHLECHTESTE AUS BEIDEN WELTEN
Ein Umzug vom Land nach Wien mag die unterschiedlichsten Beweggründe haben: Ausbildung, Arbeit, Liebe. Aber bei den meisten spielt auch ein Verlangen nach Urbanität mit.

Im Dorf aufgewachsen, sehnt man sich weg von der Landdisco, vom Cola-Rot und der Blasmusik. Hin zum abendlichen Angebot, zur Clubkultur und schnell getakteten Öffi-Verbindungen.
Und dann steht man vergangenen Samstagvormittag in der U4, sieht die ersten fünf Wiener in Lederhosen und versteht die Welt nicht mehr. Es war wieder Neustifter Kirtag, das alljährliche Bauern-Cosplay der Wiener Elite. Zwei Jahre lang mussten sich städtische Volksfestenthusiasten gedulden, die Pandemie
hatte selbst Döbling im Griff. Nun konnte die Hautevolee wieder bei zünftigen Glaserln zueinanderfinden. Auch dem Wiener ist die Sehnsucht nach dem Fremden nicht fremd. Das Provinzvolk, auf das er im übrigen Jahr schimpft, wird nun imitiert, die kulturelle Aneignung gelingt zum Teil: Man kleidet sich in Tracht, trägt dazu aber teure Sneakers. In der lebenswertesten Stadt der Welt feiert er ein Oberklasse-Landleben, das es so kaum gibt.
Am Ende des Abends geht es dann aber mit dem 35A zurück in die Stadt und die Lederne wird bis zum nächsten Jahr in den Wandschrank gehängt.
Oder auch nicht: In fünf Wochen steigt wieder das Wiener Wiesn-Fest im Prater.
STADT LEBEN
NACHLERNEN
TREND DER WOCHE
Der Sommer der Nachhilfe Vor dem Nachzipf geht’s zur Nachhilfe: Im Juli hat sich um ein Viertel mehr Schüler bei den 80 Nachhilfeinstituten von Lernquadrat angemeldet. Martina PolleresHyll von den Caritas-Lerncafés erzählt von unangekündigten Familien, die nach den Covid-Semestern verzweifelt vor ihrer Tür stünden. Es ist auch ein soziales Problem: Laut einer Arbeiterkammer-Studie vom Juni gehen Kinder aus Haushalten mit unter 2000 Euro Nettoeinkommen fast doppelt so häufig zur bezahlten Nachhilfe als Kinder von Eltern mit mehr als 3000 Euro Monatseinkommen.

NACHRANGIG
ARCHITEKTURKRITIK
Ein halb Neuer Markt Ein autofreier Platz, aus einem Guss gestaltet – es wäre zu schön gewesen. Ganz so sollte es nicht sein: Die neue, absurd anachronistische Tiefgarage darunter durchbricht mit zwei unförmigen großen Betonwimmerln die Oberfläche, zwei Rampen verhunzen den Albertinaplatz auf Jahrzehnte. Der LastMinute-Kompromiss nachbestellter Bäume ist klimatisch akzeptabel, aber optisch willkürlich, die etwas verbeult aussehenden Sitzbänke kein Ruhmesblatt. Herausgekommen ist eine österreichische Lösung, in der das Auto noch dominiert – wenn auch aus der Tiefe.

NACHBARSCHAFT
FRAGE DER WOCHE
Woher kommen all die Ratten am Schwedenplatz? In der Innenstadt wimmelt’s, auch auf Knöchelhöhe. Zwischen den Würstel- und Kebabstandbesuchern huschen die Ratten, gerade eindrücklich mehr als gewohnt. Dabei sei die Rattenpopulation nicht gewachsen, sagt der Berufszweigvorsitzende der Wiener Schädlingsbekämpfer, Peter Fiedler. Doch die Tiere zeigen sich mehr: Die Baustellen um den Schwedenplatz stören die unterirdische Ruhe und treiben Nager nach oben. Und die Lebensmittelreste aus der Gastronomie machen den Schwedenplatz auch für Ratten zum Food-Hotspot.

FALTER 34/22 33 FOTOS: APA/HARALD SCHNEIDER, MAIK NOVOTNY, DPA-ZENTRALBILD/ARNO BURGI
Magdalena Riedl will nichts damit zu tun haben
Neue Drag Artists sollten sehen, was alles möglich sei, dass auch bizarre Mischwesen erlaubt sind, die überhaupt kein Geschlecht kennen.
URBANISMUS-KOLUMNE
Eure Dragheit, Seite 34
STADTRAND

34 FALTER 34/22 STADTLEBEN
DIMITRIOS
FOTO:
VELLIS
Tamara Mascara (Raphael Massero) ist die bekannteste Drag Queen der Stadt. Heute wirbt Sprite mit ihr, der ORF hat sie 2020 als „Dancing Stars“-Teilnehmerin engagiert
Eure Dragheit
Noch nie war Drag in dieser Stadt beliebter als heute: mit eigenen Shows vom Gürtel bis nach Schönbrunn. Doch das Bild von Männern in sexy Frauenkleidern ist überholt. Die Wiener Szene bietet so viel mehr als das!
DANIELA KRENN, KATHARINA KROPSHOFER
Tamara braucht eine pinke Handtasche. Wer pinke Overknee-Stiefel mit Strasssteinen hat, dem soll es am passenden Accessoire nicht fehlen. Stolz öffnet sie auf dem Stephansplatz ihr Einkaufssackerl: darin eine neue, brieftaschengroße Clutch, knallpink, von Zara.
Haas-Haus, Stephansdom, Kärntner Straße: Obwohl an diesem Augustnachmittag eine der bekanntesten Drag Queens Österreichs durch eine der meistbesuchten Straßen des Landes läuft, dreht sich niemand nach ihr um.
Wer soll sie auch erkennen in dem schlichten, weißen Hemd und perfekt gebügelter Anzughose, ganz ohne Schminke und Perücke?
Raphael Massero hat zwei Gesichter. Seit 2011 tritt der 34-Jährige jeden Monat als Tamara Mascara, also als Drag Queen, auf. Dann wird der sonst unscheinbare Raphael zur glamourösen Frau mit dunkler Wimperntusche, dramatischen Roben, die markanten Wangenknochen mit Rouge betont. Noch vor acht Jahren war er Visagist von Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen.
Heute ist Raphael als Tamara Mascara selbstständig und als Drag Queen erfolgreich. Tamara Mascara hat Jobs als DJ und Moderatorin, macht mit der Getränkemarke Sprite eine Werbekampagne gegen Hass im Netz, vertreibt ihre eigene Kunstwimpernkollektion.
Und 2020 tanzte sie als erste Drag Queen in der ORF-Show „Dancing Stars“, das gab es zuvor in keiner familientauglichen Sendung. Ist sie nun Tamara oder Raphael? „Ob Raphael oder Tamara ist eigentlich egal. Ich bin ja beides.“
In der Stadt der gleichgeschlechtlichen Ampelpärchen und der Regenbogenparade erblühte in den vergangenen Jahren eine bunte Szene von Drag-Performern, mit verschiedenen Motivationen, Ausdrucksweisen und Stammlokalen. Drag ist erwachsen, aus dem verborgenen Geschlechterwandel eine Kunstform mit Verdienstmöglichkeiten geworden.
50 bis 60 regelmäßig auftretende Drag Queens gebe es in Wien, schätzt Tamara Mascara. Und noch wesentlich mehr Events. „Als ich damit anfing, gab es in Wien keine einzige Drag-Party“, sagt sie.
In den vergangenen Jahren habe sich die Stadt extrem verändert. Mindestens eine Party organisiert Mascara selbst pro Monat, darunter seit zehn Jahren die größte LGBTQ-Party Österreichs „The Circus“.
Früher fand diese noch in der subkulturellen Wiener Arena statt, mittlerweile ist Tamara mit ihrer Show in die spießige Babenberger Passage im ersten Bezirk gezogen. Und bei der Drag-Show „Camp
»Wir sind vollkommene Klischees und sagen der Gesellschaft aber: Da ist der Spiegel, schau dich mal an! Wenn dieses Klischee ohne Spiegel gezeigt wird, ist nicht mehr viel von dieser Message übrig
METAMORKID DRAG ARTIST
Drag“ tritt sie in den Gärten von Schönbrunn zweimal im Monat mit anderen Drag Artists auf. Vor vollem Haus.
Auch das Publikum ist Teil der Show. Ein Gast muss so viele Melanzani wie möglich unter der Kleidung verstecken und danach einen Laufsteg entlanglaufen, ohne eine zu verlieren. Angelehnt ist das an das Tucking, eine Praxis einiger Drag Queens, Penis und Hoden so am Körper anzubinden, dass die hier unerwünschten Genitalien unter der Kleidung nicht auffallen.
Das Geschäft laufe „ausgesprochen gut, ich kann wirklich nicht klagen“, sagt Mascara. Dabei hatte dieselbe noch im Conchita-Jahr 2014 im Falter-Interview gemeint: „Das geht jetzt noch ein paar Jahre so, dann ist der Drag-Trend auch wieder vorbei. Einige werden halt übrig bleiben.“
Was ist seither passiert? Wann ist die extravagante Kunstform Mainstream und das biedere Wien ihre Hauptstadt geworden?
Vorboten von Drag gibt es in Wien seit mindestens 150 Jahren. Schon in den 1880ern zeigten Zeitungen Fotos von Damen-Imitatoren, die in den damaligen Clubs und Cabarets auftraten, tanzten und unterhielten. Ein Bild zeigt Ludwig Viktor, den Bruder von Kaiser Franz Joseph, bei einem Schauspiel in Frauenkleidern.
„Klassische Travestie gab es immer“, sagt Andreas Brunner, und er muss es wissen: Brunner ist Historiker, Miterfinder der Wiener Regenbogenparade und Co-Leiter von QWien, dem Zentrum für queere Geschichte.
Die historischen Referenzen gelten aber eingeschränkt. Denn bei Drag geht es nicht nur ums Verkleiden, sondern vor allem darum, eine eigene Figur zu erschaffen.
Ein kurzes Glossar: Drag ist eine Kunstform. Die meisten Darsteller sind Teil der LGBTQCommunity, ihre Drag-Person ist Ausdruck der eigenen Biografie. Auf der Bühne mischen sich Persiflagen von angeblich weiblichen oder männlichen Verhaltensweisen. Durch die Persona und den Drag-Namen entsteht eine eigene Identität, die es mit Gesang, Kabarett, Tanz und Schauspiel auf die Bühne schafft. „Meist um perfekte Weiblichkeit zu imitieren, aber auch, um mit Geschlechterrollen zu spielen“, sagt Brunner. Klassische Travestie hingegen kommt ohne eigene Kunstfigur aus.
Von der Verkleidung zur Kunstfigur war es ein gefährlicher Weg. Zwar gab es keine gesetzlichen Einschränkungen für Männer, Frauenkleidung zu tragen, aber homosexuelle Handlungen waren bis 1971 verboten und wurden gesellschaftlich geächtet. Deswegen fand Travestie oder Drag meist im Verborgenen und in Schwulenbars statt.
Zwei Wiener Mitglieder des rechtsextremen Studenten-Freikorps ahnten 1936 im
Café Paulanerhof nicht, dass sie ihr Bier im beliebtesten Homosexuellenlokal des vierten Bezirks trinken würden.
„Bereits auf der Stiege begegneten sie junge[n] Burschen, die gegenseitig das entblößte Glied in der Hand hielten. Die Anzeiger gingen bis in das Lokal und trafen dort eine größere Anzahl von jungen Burschen, worunter ca. fünf bis sechs Frauenkleider trugen“, vermerkte die Polizei. Der Paulanerhof oder das Gasthaus Neumann am Spittelberg waren in den 30erJahren die Geheimtipps der Travestiekunst in Österreich.
Politisch ist Drag noch immer. Ein Mann im Ballkleid und mit langen Wimpern? Das sorgt auch nach 150 Jahren für schockierte Blicke. Viele Artists sind schwul. In einer EU-weiten Umfrage gaben noch 2021 mehr als 40 Prozent der befragten queeren Personen an, wegen ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Auftretens belästigt worden zu sein.
Das hat wenige gehindert, sich gegen die Konventionen zu stellen: Da war zum Beispiel Mario Soldo, eine der ersten Drag Queens Österreichs, die in den 1980er-Jahren als Dame Galaxis in der Disco U4 auftrat (und nebenbei den Namen Regenbogenparade erfand).
Oder der US-Amerikaner RuPaul, dessen Castingshow „Drag Race“ seit 2009 für Akzeptanz wirbt. 14 Staffeln zählt die Show mittlerweile, ab dieser Woche läuft das Casting für eine deutschsprachige Ausgabe.
Und da war da natürlich Conchita Wurst aus Bad Mitterndorf, die 2014 als Bärtige im Kleid den Eurovision Song Contest gewann. Und die Österreich in der öffentlichen Wahrnehmung über Nacht zu einem Drag-Kompetenzzentrum machte.
„Leute, die vorher keinen Berührungspunkt mit der Kunstform hatten, haben auf einmal angefragt: Kann ich eine Drag Queen für einen Junggesellenabschied buchen? Für meine Firmenfeier? Für meine Hochzeit“, erzählt Tamara Mascara. Mit Drag ließ sich plötzlich viel leichter Geld verdienen. Doch es könnte dazu verleiten, dass die Kunstform ihre vielen Facetten verliert.
„Wenn die Diversität in der Drag-Szene fehlt, wird es ungefährlicher, aber eben auch unpolitischer und ein bisschen fad“, sagt Andy Reiter. Ihm fehlen die unterschiedlichen Darstellungen des Drag, eben mehr als das Mann-Frau-Schema.
Reiter ist ein Urgestein der Wiener Partyszene. Seit mehr als zehn Jahren veranstaltet der 41-Jährige „Rhinoplasty“, eine der bekanntesten queeren Partys, im Club U am Karlsplatz. Auch er selbst ist dort öf-
Fortsetzung nächste Seite
STADTLEBEN FALTER 34/22 35
SHOWGIRLS:
ters in Drag unterwegs. Einen bestimmten Charakter habe er nicht, manchmal komme er sogar als Clown. Vor allem neue Drag Artists sollten sehen, was alles möglich sei, dass auch völlig bizarre Mischwesen erlaubt seien, die überhaupt kein Geschlecht kennen. So wie es ein jüngerer, grellerer, experimentierfreudiger Teil der Wiener DragSzene, beweist. Der Teil, der kein Geld mit Drag verdient.
Ein Donnerstagabend Mitte August, im kleinen Theater Spektakel im fünften Bezirk. In der Hamburger Straße steigt heute das „Drag Lab“. Lab, also Labor, heißt die Veranstaltungsreihe. Und das nicht ohne Grund. Es braucht nicht mehr als einen USB-Stick mit selbstgewähltem Song darauf, und der Einstieg als Drag Artist ist geschafft.
Newcomer können hier niederschwellig testen, wie sie beim Publikum ankommen. Zwischen 150 und 350 Leute kommen regelmäßig, fünf Euro macht der Eintritt, plus das gern gesehene Trinkgeld für die Darbietenden.
Der Schweiß tropft an diesem Abend von der Decke. Von Dirndl bis Netzstrümpfen ist alles präsent, selbst die Zuschauer sind so schrill und extravagant gekleidet, dass nicht zu ermessen ist, wer von ihnen noch auf die Bühne steigen wird. Der Club will ein Safe Space für sie sein, wo man sein kann, wie man sein will.
Nicht ohne Grund. Selbst die bekannten Drag Artists sind vor Übergriffen nicht sicher. Zum Beispiel Meta, kurz für Metamorkid. Während sie vor dem Lokal eine Zigarette raucht, schiebt ein unbekannter Mann im Vorbeigehen Metas Kleid zur Seite, um dem Drag Artist auf die Brust zu greifen. Gefragt hat er nicht.
Solche Vorfälle seien normal, seufzt Meta ein paar Minuten später im Backstagebereich. Der oberösterreichische Dialekt will nicht ganz zur „Attitude“ passen. Meta macht Drag, seit sie 16 Jahre ist, und hat viele inspiriert, die heute im Drag Lab auftreten.
So glamourös sich die Artists auf der Bühne geben, so karg ist ihr Backstagebereich: Die abblätternde Wandfarbe, in den Ecken Kerzenleuchter, Kunsthaar, Tape, Zylinder. Underground eben. In Gesprächen miteinander wechseln die Queens und Kings und Artists immer wieder zwischen Englisch und Deutsch, Ländergrenzen sind im Drag nachrangig. Welche Menschen sind das, die sich hier am Wochenende ihrer Rollen und Sitten entledigen?
Zum Beispiel Blood Sugar. Sie ist zum ersten Mal hier, Namensgeber war der Sensor zur Blutzuckermessung am Oberarm der 16-jährigen Transperson. Nervös übt sie ihre Tanzschritte für den anstehenden Auftritt noch vor dem Spiegel, wie sie es schon so oft zuhause getan hat, schiebt sich einen Damenstrumpf über den lockigen Schopf, damit die Perücke auch alles verdeckt.
Blood Sugar geht in Simmering in die Schule. Drag sei die Chance, sich als Transperson ausdrücken zu können und andere Leute glücklich zu machen, sagt Blood Sugar. Sie ist bereit: Kurz bevor sie auf die Bühne tritt, befestigt sie die Pumps noch mit Klebeband an den Füßen. Man weiß ja nie.
Drag-Glossar
Drag Queen ist jemand, der (übertriebene) Weiblichkeit in einer Show performt
Drag King ist jemand, der (übertriebene) Männlichkeit in einer Show performt
Drag Artist ist der Sammelbegriff für alle, die Drag machen
Travestie
Das französische Wort „travestir“ bedeutet verkleiden. Travestiekünstler verkleiden sich als ein anderes Geschlecht
Cross Dressing meint das Tragen von Kleidung, die nach gängigen Normen nicht dem eigenen Geschlecht entspricht
queer
Sammelbegriff für alle, die nicht in das überlieferte Mann-Frau-Bild der Gesellschaft passen (wollen)
Drag heißt Hingabe von Zeit, Geld und Ideen. Der Artist namens 13 ist heute als Latexteufel gekommen und fixer Bestandteil jeder „Drag Lab Show“ in Wien. Die schwarze Latexhose sitzt knalleng, die Hörner aus Gaffer Tape bewegen sich im Takt.
Dabei sei das noch „das unaufwändigste Outfit, das ich gemacht hab“, so 13. Auf Instagram findet sich der Beleg in Form eines gruselig-prächtigen Spongebob-Schwammkopf-Kostüms.
Drag Artist zu sein geht auch ohne ausgestopfte BHs und makellose Schminke. „Ein befreundeter Clubbesitzer hat früher zu mir gesagt, ich bräuchte zwei Dinge, um erfolgreich zu werden: Titten und einen guten Namen“, sagt der Drag-Star Tamara Mascara.
Von der Losung ist nicht mehr viel übrig. Auf den BH verzichtete sie ein paar Jahre später, der Name aber blieb. „Mascara funktioniert in jeder Sprache.“
Im Drag Lab sind die Performer richtig bunt: Der Drag King „Karl Klit“ gibt heute einen verprügelten Buben, „Hairy Mary“ tanzt mit Corsage und einem Oberlippenbart aus Perlen auf der Rettungsgasse, die sich in der Menge gebildet hat und nun als Laufsteg dient. „Blood Sugar“ gibt ein Bühnendebüt mit dramatischen sogenannten Death Drops, bei denen sich die Künstlerin zu Kylie Minogue wie tot auf den Boden fallen lässt.

Durch die Ekstase im Publikum, den Zuspruch lässt sich auch schnell vergessen, wie unsicher sich Blood Sugar als Transperson auf den Straßen Simmerings fühlt. Auch darum geht es bei Drag: auszubrechen.
Das Drag Lab zeigt die Vielfalt dieser Kunstform. Es geht nicht nur um aufwändige, glamouröse Bühnenshows, sondern auch um den Spaß bei den Shows mit gleichgesinnten Gästen aus der queeren Community.
Die Darstellung einer schönen Frau ist nur eine von vielen Spielarten. „Es gibt in Berlin die sogenannten Trümmertransen mit schlechten Perücken und zerrissenen Strumpfhosen. Sie sind hässlich und billig hergerichtet“, sagt Andy Reiter.
Die verschiedenen Seiten des Drags gelte es zu fördern und zu zeigen. Für jun-
ge queere Menschen sind unterschiedliche Vorbilder wichtig, um sich selbst zu finden. Denn auch das zeigen vereinzelte Untersuchungen aus den USA: Drag Queens und Kings machen überwiegend positive Erfahrungen, wenn sie auftreten, sie gehen gestärkt von der Bühne.
Auch Meta befürchtet, dass Drag kommerziell und einseitig werden könnte. Nur in Drag aufzutreten und dabei schön zu sein sei heute nicht mehr genug.
Der politische Kern der Kunstform müsse erhalten bleiben. „Wir stellen vollkommene Klischees dar und sagen der Gesellschaft dabei: Da ist der Spiegel, schau dich mal an! Wenn dieses Klischee nun ohne Spiegel gezeigt wird, ist nicht mehr viel von dieser Message übrig.“
Drag ist in Wien gerade so sichtbar wie nie zuvor. Galionsfiguren wie Conchita oder Tamara Mascara haben es aus der Community getragen. Bei ihren Shows in Schönbrunn habe Tamara Mascara viele heterosexuelle Besucher, die eben neugierig sind, etwas anderes wollen.
Es ist ein Zeichen von gesunkenen Hemmschwellen und gestiegener Kommerzialisierung – aber auch von mehr Anerkennung für die Kunstform. Und das sei prinzipiell gut für Randgruppen einer Gesellschaft, wie Drag Artists und auch die LGBTQ-Community, finden Andy Reiter und Tamara Mascara.
Wie stehen also die Chancen für den Drag-Standort Wien acht Jahre nach dem Conchita-Hype, als Tamara Mascara dem Drag schon seine Zukunft absprach? „Vielleicht war es etwas avantgardistisch zu sagen, dass es schnell vorbei sein wird“, sagt sie heute. „Von mir aus könnte es so weitergehen wie jetzt.“
Drag-Veteran Andy Reiter würde jedem empfehlen, es auszuprobieren. „Wenn man sich traut, dann einfach mal machen. Es ist eine gute Erfahrung für jeden, auch für Frauen oder ältere Männer.“ Warum? „Weil es einfach eine komplett andere Erfahrung ist, die einem vor Augen führt, was soziales Geschlecht ist und wie konstruiert das ist.“
Und nicht zuletzt: „Dass man nicht immer alles so ernst nehmen muss.“ F
36 FALTER 34/22 STADTLEBEN
Fortsetzung von Seite 35 FOTO: CHRISTOPHER MAVRIC







STADTLEBEN FALTER 34/22 37 FOTO: MOHAMMADSADEGH SHEIKHREZAI
„Wenn die Diversität in der Drag-Szene fehlt, wird es ungefährlicher, aber eben auch unpolitischer und ein bisschen fad“
DER VERANSTALTER ANDY REITER
Oben: Metamorkid und Dopa Mania veranstalten jede Woche das „Drag Lab“ für die queere Community. Unten: Tamara Mascara bei ihrer Show in der Landtmann’s Jausenstation in Schönbrunn
Von Travestie über Cross-Dressing zu Drag: Die Geschichte der Persiflage aufs andere Geschlecht ist lang. Marcel André (oben links) trat mit Peter Alexander auf, Hermann von Teschenberg (unten links) musste ins Exil. Die Wiener Szene traf sich im Café Paulanerhof (unten rechts)
FOTO: ARCHIV FOTO: APA/BRANDSTAETTER/PICTUREDESK FOTO: AUGUST STAUDA/WIEN MUSEUM FOTO: WIKIPEDIA FOTO: CHRISTOPHER MAVRIC FOTO: CHRISTOPHER MAVRIC
Blood Sugar (links im Jeans-Minirock) macht sich im Backstagebereich der Veranstaltungsreihe „Drag Lab“ fertig, bevor es zum allerersten Mal auf die Bühne geht (rechts)
Strandbad
Alte Donau
geöffnet bis 18. September von 9 bis 19.30 Uhr, am Wochenende ab 8 Uhr
Anreise
Am besten mit der U1 zur Station Alte Donau, dann mit dem Bus 20A/B oder ewig zu Fuß
0,6–1,4 Meter
tief sind die Becken Mit anderen Worten: Man kann stehen
1918 wurde das Bad eröffnet und 1960/61 umgebaut. Retro!
3,50 Euro
kostet ein SangriaSlushy. Wirklich gut ist der aber nicht
3,4 Hektar
groß ist das Areal. Schattenplätze genug
Das bessere Gänsehäufel?
RIEDL
Es sind so lange acht Minuten von der U-Bahn-Station Alte Donau bis zum gleichnamigen Strandbad. Ein verheißungsvolles Freibad reiht sich hier ans andere, der Bus fährt nur alle 20 Minuten, die Sonne brennt, Bäume fehlen.
Manche schwimmnudel- und badetaschenbepackten Familien biegen ermattet ins näher gelegene Bundesbad Alte Donau. Das betreibt nicht die Stadt, sondern die Republik, es ist ungefähr gleich groß, hat aber keine Schwimmbecken. Also stellen wir uns noch den letzten Metern Gehweg. Kurz vorm Kollaps winkt der Eingang ins städtische Paradies.
Und vor einem Kabinenkomplex aus den 60er-Jahren eine radlertrinkende Damenrunde. Eine Frau mit weißen Haaren und flotter Sonnenbrille kenne mittlerweile fast alle Kabinenmieter. Seit 22 Jahren komme sie her. „Heuer schon 65-mal. Es ist einfach gemütlicher und gemeinschaftlicher als das Gänsehäufel. Dort ist es mir zu groß.“ Von den hiesigen Kabinen aus übersieht man den gesamten Badestrand. Eltern ermöglicht das einen entspannteren Badetag.
Die Liegewiese des Strandbads Alte Donau ist nach der beschwerlichen Anreise reizlos, ehestmöglich muss der Schweiß runter. Über den Kiesstrand watet man zur Donaumitte, beim Blick zurück auf den weißen Kies stellen
sich Urlaubsgefühle ein, aber Achtung: Badende teilen sich das Wasser mit einer fünfköpfigen Schwanenfamilie, die hier ihre Runden zieht und im Zweifel ihr Revier verteidigt.
Wem der fischige Duft des Donauwassers zu naturnah ist, der muss nur dem strengen Chlorgeruch folgen. Hinter dem Kabinenkomplex eröffnet sich die dreiteilige Beckenlandschaft des Bads: links das Kinderbecken mit silberner Babyelefantenrutsche. Mittig das Mehrzweckbecken, in dem Kinder aufeinanderklettern, eins, zwei, drei übereinander, bevor der Turm in sich zusammenfällt. Rechts das Sportbecken, das sich zum Längenschwimmen nicht empfiehlt. Weil sich die wenigsten Gäste an die Bahnenverkehrsordnung halten, schwimmt, wer schwimmen will, im Zickzack.
Seinen Vortrag unterbricht eine ältere Dame, sie möchte eine Kabine für die nächste Saison, das Stadionbad sei zu laut geworden. Herr Davidek drückt ihr eine Telefonnummer in die Hand. „Unsere größte Konkurrenz ist aber das Gänsehäufel. Das Bundesbad nebenan hat keine Becken, nur den Flusszugang. Alle, die das nicht mögen, kommen zu uns.“
Spiel-, Volleyball- und Fußballplatz sind im Eintrittspreis enthalten, sieben Minuten im Riesentrampolin kosten 2,50 Euro. An diesem Donnerstagnachmittag ist das Trampolin trotz 32 Grad Außentemperatur voll, das Strandbad ist eben familienfreundlich. Mit Schwimmflügeln und pinken Aufblasflamingos bewaffnet sausen Kniehohe über das 34.000 Quadratmeter große Gelände. „Aber wir haben auch ruhigere Fleckchen“, meint Davidek.
Die Falter-FreibadSommerserie.

Diesmal: Strandbad Alte Donau

Wöchentlich erkunden wir Wiener Freibäder – als Badegäste und kulinarisch. Nächste Woche: Stadionbad
Neun Bademeister sorgen für Sicherheit, zumindest laut Dienstvertrag, Unruhen sind im Strandbad selten. Den Badebetrieb leitet Herr Davidek, wenn er nicht im Büro sitzt, wird er überall gebraucht, teilt Nadel und Pinzette für eingezogene Splitter aus oder beantwortet drängende Fragen zu Wetter und Kästchen.
„Unser Bad gibt es seit 1918, an Hitzetagen kommen bis zu 5000 zum Schwimmen. Manche schon seit 40 Jahren.“ Ein Satz, so viel Inhalt, die nackten Fakten hat sich Herr Davidek zur Sicherheit auf einem Zettel notiert.
Im geschlechtergetrennten FKK-Bereich lässt sich eine Seniorinnengruppe braten, ums Eck strömt der Duft ätherischer Öle und Meditationsmusik. Eine Massagetherapeutin hat ihren Tisch aufgeschlagen und knetet um 28 Euro à halbe Stunde Verspannungen weg. „Urlaubsgefühl pur“, sagt Davidek. Dem Strandbad Alte Donau mangelt es an weitererzählwürdigen Alleinstellungsmerkmalen, es ist der gute Kompromiss für alle.
Auf der in die Jahre gekommenen Damentoilette hält eine junge Frau den Kopf unter den Wasserhahn. Sie hat ihren Bikini vergessen. „Ich kühl’ mich einfach so ab, dann hab ich’s trotzdem fein.“ Nochmal heim, das Badezeug holen, käme für sie nicht infrage. „Den Hitzeschlag vom Hinweg tu ich mir nicht nochmal an.“ F
38 FALTER 34/22 SCHWIMMBÄDER
VIGNETTEN: PM HOFFMANN
MAGDALENA
und Chlorbaden – im Strandbad Alte Donau geht beides. Und dazwischen genügend Schatten für Tausende. Teil 8 der Falter-Freibad-Sommerserie
Donauschwimmen
FOTOS: HERIBERT CORN
Die Alte Donau ist die Adria Wiens, neun Strandbäder, dazu noch ein paar Kilometer Wildbadeplätze, da braucht’s schon ganz schön was zu essen.
Wobei das Strandbad selbst da wirklich nicht schlecht ausgestattet ist: Bis vor zwei Jahren gurkte das Buffet des Bades ja eher ein bisschen auf Nachkriegsniveau herum, ein bisserl sehr retro. Da war der unmittelbare Badekonkurrent – das Bundesbad Alte Donau mit seinem pittoresken Buffet-Pavillon am Wasser – besser aufgestellt, ein paar Schwimmzüge rüber zum kleinen West-Wasserzugang eine Überlegung wert.
2014 übernahm diesen Pavillon dann auch noch die junge Generation der Gastronomen-Familie Bitzinger, was einen Professionalisierungsschub mit sich brachte. Inzwischen scheint da aber eine gewisse Lässigkeit eingezogen zu sein, das afghanische Joghurt-Zitronen-Hühnchen entschuldigt nicht den panierten Pappendeckel aka „kleines Schnitzel“.

Vor zwei Jahren legte das Strandbad dann jedenfalls nach: Das öde Buffet wurde zur Donaubrise mit ganz schön attraktivem Angebot, freundlichem Personal, angenehmem Erscheinungsbild und erträglichen Preisen. Die Performance hier ist um Dimensionen besser als bei der Donaubrise am Gänsehäufel und die Portionen sind um eine Nuance preiswerter als im Schönbrunner Bad (gleicher Betreiber wie Donaubrise).
Und dass die frittierten Ährenfische vorige Woche in Schönbrunn nicht zu bekommen waren, wundert einen spätestens dann nicht mehr, wenn die Portion „Fisherman’s Frites“ am Strandbad-Tisch steht: ein halbes Kilo knusprig frittierter Fischlein, allein kaum zu schaffen.
Alle Pommes dieser Welt
Apropos allein: Die Donaubrise hat dann auch noch einen Take-awayAbleger ums Eck für typisches Bade-Streetfood, also Pommes in allen hippen Varianten, getrüffelt, aus Süßkartoffeln, mit Guacamole. Ein Cocktail-Standl gibt’s auch noch und eine Espresso-Bar mit dem eher abschreckenden Namen „Kaffeetschi“.
Wir halten fest: Der BundesbadBitzinger kann Lage am Wasser und architektonischen Reiz des Pavillons geltend machen; die Strandbad-Donaubrise kocht allerdings besser.
Angenommen, Essen steht vorher oder nachher auf der Agenda: Das Brunchhouse am Irissee beeindruckt vor allem architektonisch. Das Seerestaurant von Architekt Kurt Schlauss, 1964 anlässlich der Gartenmesse WIG eröffnet, wurde vor et-
was mehr als zehn Jahren vom koreanischen Kulturinstitut erstanden und renoviert. Die kulinarische Komponente übernahm zuerst das kleine koreanische Restaurant Arisu, dann das Brunchhouse, das amerikanisches Frühstück anbietet.
Nach dem Bade Sichuan
Ebenfalls eindrucksvoll, allerdings auch kulinarisch, ist das China Sichuan, schon seit vielen Jahren zuverlässig eines der besten China-Restaurants der Stadt und auch noch mit Koi-Teichen und Tee-Pagoden ausgestattet. Zu seiner Anfangszeit schickte China zahlreiche ausgezeichnete Köche in dieses Restaurant, von denen erfreulicherweise viele blieben und die chinesische Gastronomie Wiens weiterbrachten.

Wem der Sinn nach Wurst, Paniertem und Frittiertem steht, wird beim Buffet Christine glücklich, aber auch das Lokal im riesigen Sportcenter Donaucity ist seit zwei Jahren ganz gut: Das Oide Donau definiert sich als „Wiener Diner“, was sich in einer um Schnitzel und Kaiserschmarren ergänzten Diner-Karte äußert. Wirklich interessant wird’s aber mittags, denn da gibt’s echtes Essen wie gegrillten Lammrücken oder Zitronenhuhn um wenig Geld.
Fischbeuschel gegen die Hitze Richtung Nordwesten werden die Distanzen etwas größer, aber der Weg lohnt sich: Etwa zum wunderbar schrägen Golfstüberl beim Minigolfplatz, wo man sommerlich-leichte Gerichte wie Zwiebelrostbraten, Blunzengröstel, Surschnitzel in Kürbispanade oder Kässpätzle zu VorKrisen-Preisen bekommt. Der Renner sind hier allerdings die Sachen vom Holzkohlengrill, allesamt garniert und mit Pommes, wie früher.
Der NEUERWirt erhielt vor vier Jahren ein Update, also ein gepflegt modernes Interieur und eine tadellos umgesetzte Wiener Küche, die Terrasse am Wasser war schon vorher super. Von Mittwoch bis Sonntag wird auch hier über Holzkohle gegrillt, Fisch, Fleisch und Geflügel.
Wenn man so weit gehen will, ist der Hupfer über den Birnersteg aber auch schon egal, denn hier ist der Birner, und der Birner ist einzigartig: ein uraltes Gasthaus, seit den 1920ern quasi unverändert, auf der Karte keinerlei Kompromisse an die Modernität, also gebackene Leber, Pusztaschnitzel und vor allem Fischbeuschelsuppe, der obligatorische Birner-Klassiker. Die „hängenden Gastgärten“ des Birner sind legendär, ein Tisch auf der Galerie direkt über dem Wasser heiß begehrt. Sonnenbrand und satt.
Donaubrise 22, Arbeiterstrandbadstr. 91, tägl. 9–19.30 Uhr, www.donaubrise.at


Bitzinger im Bundesbad 22., Arbeiterstrandbadstr. 93, Tel. 0660/913 13 93, tägl. 8–19 Uhr, www.schankwirtschaft.at
Brunchhouse am Irissee 22., Arbeiterstrandbadstr. 122a, Tel. 0676/326 67 85, Mi–Fr 9–16, Sa, So 9–18 Uhr, www.brunchhouse.at
China Sichuan 22., Arbeiterstrandbadstr. 122, Tel. 01/263 37 13, Mo–Fr 11–14.30, 17.30–23, Sa, So 11–23 Uhr, www.thesichuan.com
Buffet Christine 22., Arbeiterstrandbadstr. 128, Tel. 0680/126 81 51, bei Sonne tägl. 10–24 Uhr
Oide Donau 22., Arbeiterstrandbadstr. 128, Tel. 01/263 27 38, tägl. 7.30–22.30 Uhr, www.oidedonau.wien

Golfstüberl 21., Arbeiterstrandbadstr., Tel. 01/263 65 65, Mo–Fr 10–21, Sa, So 9–21 Uhr, www.golfstueberl.at
NEUERWirt 21., Ferdinand-Kaufmann-Pl. 2, Tel. 01/263 23 17, Mo–Do 11–22, Fr, Sa 11–23, So 11–21.30 Uhr, www.neuerwirt.at
Strandgasthaus Birner 21., Obere Alte Donau 47, Tel. 01/271 53 36, tägl. 10–22 Uhr, www.gasthausbirner.at
Badbuffet Donaubrise schmecken frittierter Fisch
ESSEN • TRINKEN FALTER 34/22 39
Das China Sichuan zwischen Koi-Teichen weiß seit Jahren zu überwältigen
Im
und getrüffelte Pommes
Florian Holzer begibt sich auf die Suche nach kulinarischen Mikrokosmen in Wiener Grätzeln – im Sommer in Freibädern ARGE
Wien, wo es isst Sieger im Badebuffet-Duell GRAFIK:
KARTO
Mehr davon: City von oben
Wienerinnen und Wiener hatten Höhenangst. Einmal im Leben Türmerstube oder Riesenrad, das reichte. Gegessen oder getrunken wurde lieber zu ebener Erde. Versuche gab es, etwa das Café im obersten Stock des Herrengassen-Hochhauses bis in die 1960er-Jahre. Hier kann man auf die Innenstadt runterschauen:
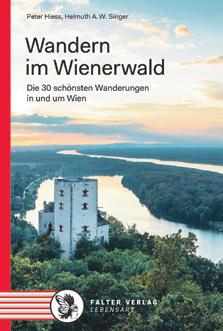
Do & Co Mit dem Do & Co wurde 1989 der Wiener DachterrassenBann gebrochen. Nun wollten alle da rauf. Dass nicht alle raufgelassen wurden, war das Erfolgskonzept des Lokals. Die austro-asiatisch-mediterrane Linie hat sich übrigens seit damals kaum geändert.
1., Stephansplatz 12/Haas-Haus, Tel. 01/535 39 69, tägl. 12–15, 18–24 Uhr, www.docohotel.com
Sky Nächster Versuch: Beim Umbau des Steffl-Kaufhauses in den 1990ern wurde auch eine Bar und ein Terrassen-Restaurant im obersten Stock installiert. Trotz mehrfacher Versuche, hier eine attraktive Küche zu lancieren, blieb die große Zustimmung aus. Mittlerweile kocht man für Touristen ein Programm, das dem von Do & Co ähnelt.
1., Kärntner Str. 19/Steffl, Tel. 01/513 17 12-735, Mo–Sa 10–24, So, Fei 12–22 Uhr, www.skybox.at
Lamee Rooftop Das eigene (und damals irrsinnig aufwändig gestaltete) Restaurant wurde aufgegeben und ist heute ein Burger-Lokal. Die kleine, sehr bunte Dachterrassenbar behielt das Boutique-Hotel aber. Nett. 1., Lichtensteg 4, Tel. 01/532 22 40, täglich 16–1 Uhr, www.lameerooftop.com

Organics Sky Garden Seit einiger Zeit findet am Dach der niederösterreichischen Landesbank ein sommerliches Bar-Pop-up statt. Das regelmäßig die Dachterrassen-Rankings anführt, was aber natürlich auch daran liegen kann, dass es sich hier um eine Red-Bull-Promotion handelt. 1., Wipplinger Straße 2, Mo–Sa 17–24 Uhr, www.organicsskygarden.com
Das Schick Ein Ausflug in die 1960er: Das kleine Restaurant des Hotels am Parkring hat zwar keine Terrasse, vermittelt vom zwölften Stock aber trotzdem die Faszination, die der Ausblick auf Wien von oben damals vermittelt haben muss. 1., Parkring 12, Tel. 01/514 80-417, Mi–Sa, Fei 18–23 Uhr, www.das-schick.at
Von oben herab
Wieder ein neues Luxushotel, mit einer Bar, die ungewöhnliche Ausblicke ermöglicht
I m Jahr 1979 dachte sich die Milliardenerbin Caroline Rose Hunt, dass es eine neue Luxushotel-Kette bräuchte, und fing in Dallas an zu planen. Ein paar Häuser kamen im Laufe der Jahre noch dazu, 2011 erwarb dann der Hongkonger Milliardär Henry Cheng die Kette und ging gleich einmal groß einkaufen: The Carlyle in New York, Chancery Court in London, Hôtel de Crillon in Paris, gerade wurde auch das Schloss Fuschl im Salzkammergut gekauft.
Die ehemalige Zentrale der Erste Bank am Graben erwarb er schon vor ein paar Jahren, seit Anfang August ist das Luxushotel fertig. Und es hat auch ein Restaurant im Dachgeschoß, mit eigenem Eingang, tollem Ausblick, guter Küche, reichlich Brimborium und ziemlich blödem Namen, nämlich Neue Hoheit.
Die Preisspanne des Restaurants liegt jenseits dessen, was ich hier guten Gewissens empfehlen mag, allerdings gibt’s auch eine Bar, in der sich der Duft des Reichtums ebenfalls atmen lässt, aber halt um sehr viel weniger Geld.

Okay, als niederschwellig kann man auch die Bar nicht wirklich bezeichnen: Beim Eingang wirst du ab-
gecheckt, bevor du in den Aufzug darfst, ein Funkspruch „eine Person, Bar“ geht nach oben. Dort erwarten dich dann drei ernste Menschen in schwarzen Anzügen, die dich auch nur in Begleitung die schmale Treppe zur Bar raufgehen lassen … Bitte, entspannt euch!
Wem bis dahin nicht die Lust vergangen ist, kommt nun allerdings auf seine Kosten: Denn erstens ist die Bar lässig, klein, dezent, klassisch, geschmackvoll, aus Holz, Leder und Marmor, so wie Hotelbars aussehen müssen. Und sie hat eine Terrasse: auch klein, nur vier Pulte und vier Tischchen, aber mit Blick in die
Bognergasse, über den Kohlmarkt, rüber zum Hochhaus, an der Peterskuppel vorbei zum Stephansdom, in die Dachterrassen-Apartments des Goldenen Quartiers, die man von unten gar nicht sieht.
Hinter der Bar steht Daniel, der zuvor im Hotel Fontenay an der Hamburger Außenalster mixte. Er arbeitet ruhig und konzentriert, verzichtet angenehmerweise auf Pirouetten und Attitüden. Seine Empfehlung für diesen heißen, schwülen Tag ist der Old Cuban: dunkler Rum mit Angostura, Limette und Zuckersirup auf Eis, abgeseiht und mit Champagner aufgegossen. Liegt hier gewissermaßen auf der Hand – und ist ziemlich gut. Die Pecannüsse mit Teriyaki-Kruste übrigens auch. Den Dirty Martini rührt er vorsichtig auf Eis, der Wermut-Anteil ist hoch, jener der Olivenlake auch, sehr gut. Wieder Nüsschen.
Die Drinks sind nicht billig, mit 20 Euro pro Stück muss man rechnen. Bekommt dafür aber einen tollen Cocktail und das sehr verführerische Gefühl von Luxus.
Resümee:
Neue Hoheit Bar 1., Tuchlauben 4, Mi, Do, So 17–24, Fr, Sa 17–1 Uhr, www.rosewoodhotels.com/en/vienna/dining/neue-hoheit-bar
WANDER BARES WIEN
Eine kleine Hotelbar, der es zwar völlig an Entspanntheit fehlt, aber nicht an Atmosphäre, guten Cocktails und tollem Ausblick.
40 FALTER 34/22 ESSEN • TRINKEN
WANDERN IM WIENERWALD 30 Touren in und um Wien
„Eine Person, Bar!“ Anzugträger mit Funkgeräten begleiten einen auf diese Terrasse
4000 weitere Lokale finden Sie im Lokalführer „Wien, wie es isst“. www.falter.at
GRAFIK: ARGE KARTO
FOTO: HERIBERT CORN
LOKALKRITIK: FLORIAN HOLZER
Das Sommer-Reh
NINA KALTENBRUNNER
Echt jetzt, du kochst Rehragout?“, fragt die zum Essen geladene Freundin ungläubig. „Heute, am heißesten aller Tage?“
Die Frage hat durchaus ihre Berechtigung. Besonders dann, wenn man Rehragout mit schwerer Wein- und Wurzelwerksauce, Preiselbeeren und Knödel assoziiert.
Reh geht aber auch anders: leicht und durchaus sommerlich. Außerdem musste ich Platz in Freund F.s Gefriertruhe machen, wo ich mein(e) Reh(e) „geparkt“ hatte, als ich von der großen Wohnung mit der großen Küche und dem großen Tiefkühlschrank in die kleine Wohnung mit der kleinen Küche und dem Mini-Tiefkühlfach gezogen bin.
Freund F. wollte nämlich Eiswürfel machen und fand dafür vor lauter Reh keinen Platz mehr. Ich hatte Mitleid, schließlich war es wirklich richtig heiß. Also gut, es wird Rehragout geben, leicht orientalisch angehaucht, mit Gemüse, Kichererbsen, Zitrone und viel frischer Minze. Dazu gibt es Couscous, den nachfolgend beschriebenen marokkanischen Karottensalat und eventuell einen Klacks Joghurt. Herrlich, ganz besonders bei Hitze.
Einfach, aber einfach gut
An sehr heißen Tagen ist es ratsam, mit dem Karottensalat rechtzeitig zu beginnen, damit er gut durchkühlen kann. An weniger heißen Tagen kann er lauwarm aufgetischt werden. So oder so schmeckt er köstlich. Das Rezept dafür stammt (wieder einmal) von Yotam Ottolenghi, der meisterlich wie kein anderer mit raffinierter Würze jeder noch so simplen Zutat eine gewisse Extravaganz verleiht. In diesem Fall ist die Zutat ein Kilo knackiger Karotten. Die wir folgen-
dermaßen zubereiten: Wir schälen sie, halbieren sie je nach Größe, und schneiden sie in ein Zentimeter breite Scheiben.
Danach köcheln wir sie in Salzwasser bei reduzierter Hitze circa zehn Minuten lang, bis sie gar, aber noch knackig sind, seihen sie ab und lassen sie gut abtropfen. Nun hacken wir eine mittelgroße Zwiebel sehr fein und braten sie in einer Pfanne mit Olivenöl bei mittlerer Hitze so lange, bis sie weich und leicht gebräunt ist.
Jetzt geben wir die Karotten dazu, plus: 1 TL Zucker, eine Prise gemahlene Nelken, zwei Prisen gemahlenen Ingwer, ½ TL gemahlenen Koriander, ¾ TL gemahlenen Zimt, 1 TL Paprika Edelsüß, 1 TL gemahlenen Kreuzkümmel sowie 3 gehackte Knoblauchzehen, zwei fein gehackte grüne Chilischoten, 1 EL gehackte Schalen von einer eingelegten Zitrone, 1 fein gehackte Frühlingszwiebel und 1 EL vom richtig guten Weißweinessig. Das mischen wir al-
les gut durch, nehmen es vom Herd, würzen großzügig mit Salz und lassen es abkühlen. Ein heißer Tipp ist, die trockenen Gewürze abzumessen und miteinander zu vermischen, bevor man sie zu den Karotten in die Pfanne gibt.
Das Beste kommt zum Schluss Wenn der Salat gut gekühlt ist und ordentlich durchgezogen hat, schmecken wir ihn ab und vermengen ihn mit einem halben Bund gehacktem Koriander. Fertig. Dazu empfiehlt Herr Ottolenghi etwas fettes Naturjoghurt – wie im Übrigen zu den meisten seiner Gerichte.
Wir empfehlen zum Rehragout, das durch die Melanzani, Paprika und Ajvar eine angenehme Frische und durch die Gewürze (Ras el Hanout) auch eine feine orientalische Note erhält, klassisch Couscous. Gerne auch noch einen Klacks vom fetten Joghurt dazu, darüber kommt frische Minze und etwas Zitronensaft. Viel sommerlicher geht Reh gar nicht! Dazu könnte man – ganz authentisch – heißen Minztee trinken oder auch irgendetwas mit ganz vielen Eiswürfeln drin.
Das Beste kommt allerdings, wie immer, zum Schluss. Am nächsten Tag nämlich wurden die Reste vom reichlich bemessenen Karottensalat mit dem verbliebenen (wenigen) Rehragout und ausreichend Couscous vermengt, dann mit ein wenig gutem Olivenöl und Zitronensaft mariniert und mit viel Koriander und Minze bestreut und kalt gegessen – richtig gut!
Richtig zubereitet, schmeckt Rehragout auch an besonders heißen Sommertagen
FOTOS: NINA KALTENBRUNNER
Ebenda Über diese Seite
Hier behandeln Nina Kaltenbrunner, Werner Meisinger und Katharina Seiser jede Woche das Thema Kochen aus unterschiedlicher Perspektive
Glücklicherweise ist aber immer noch ausreichend Reh in F.s Tiefkühlschrank, die kälteren Tage kommen bestimmt, und dann wird es Rehragout in mit viel Wein und Wurzelwerk geschmorten Saucen geben, Knödeln und Preiselbeeren. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.
Rehragout mit Karottensalat und Couscous

1kg Rehkeule, in 3–4 cm Würfeln 3 Kardamomkapseln, gemörsert 2 ½ TL Ras el Hanout Salz

6 EL Sonnenblumenöl 1 EL Tomatenmark
2 EL Ajvar, mild 300 ml Wildfond 2 rote Zwiebeln, geviertelt
1 Glas Kichererbsen (265 g Abtropfgewicht) 250 g Melanzani, in Scheiben/Würfeln (2 cm) 1 roter Paprika/Pfefferoni, in Scheiben 5 Stiele Minze 1 Zitrone 2 EL Schwarzkümmel
Zubereitung Fleisch mit Kardamom, Ras el Hanout und Salz gut einreiben, in einem Bräter in Öl rundum anbraten, Tomatenmark, Ajvar, Wildfond und 100 ml Wasser zugeben und für 45 Min. bei 200 °C ins Rohr.
In einer Pfanne Zwiebeln, Melanzani und Paprika goldbraun rösten (ca. 10 Min.). Gemüse und Kichererbsen zum Fleisch in den Bräter geben und weitere 25 bis 30 Min. garen. Mit Zitrone abschmecken und mit Minze & Schwarzkümmel servieren. Dazu: Couscous & marokkanischer Karottensalat (Rezept siehe links)
ESSEN • TRINKEN FALTER 34/22 41
Meisterkoch Ottolenghi würde hier noch einen Klacks Joghurt empfehlen – wir auch!
GERICHTSBERICHT:
Orientalische Gewürze, Gemüse und viel frische Minze machen Rehragout hitzetauglich
PETERS TIERGARTEN
FRAGESPIELE
I m Falter.Morgen-Newsletter gibt es die „Frage des Tages“. Ich lese sie gern, weil nicht bildungsbürgerliches Wissen abgefragt wird, sondern ein Thema mit Wien-Bezug in eine Quizfrage verpackt und so eine kleine, feine Geschichte erzählt wird.
Eine ganz andere Form des Frage-Antwort-Spiels gibt es in der Bundespolitik. Das Recht, dass Abgeordnete der Regierung Fragen stellen können, ist ein wichtiges demokratisches Gut, das auch gewissen Ritualen unterliegt. Wenn zum Beispiel eine NGO wie der WWF darüber informiert, dass innerhalb von acht Jahren insgesamt 200 Tonnen Haiprodukte im Wert von 2,6 Milliarden US-Dollar nach Österreich eingeführt wurden, dann werden nach einer gewissen Latenzzeit von den Abgeordneten parlamentarische Anfragen dazu gestellt.
Zu Recht, denn das Fleisch der Haifische ist wegen ihres hohen Harnsäureanteils kaum genießbar, nur die knorpeligen Flossen sind nach mehrstündigem Kochen essbar. Haie sind eigentlich nur Beifang, die Flossen werden den Tieren auf hoher
See bei lebendigem Leib abgeschnitten, der Körper entsorgt. Im Handel ist dieses Fleisch dann unter verschleiernden Bezeichnungen wie Schillerlocke, Speckfisch oder Seeaal erhältlich.
Seit 2013 ist zwar durch die „Fins Naturally Attached“-Verordnung der EU die Lagerung, Umladung und Anlandung aller Haifischflossen in EUGewässern und auf allen EU-Schiffen verboten, dennoch werden jährlich knapp 3500 Tonnen Flossen aus der EU exportiert.

Grund genug für eine klare Frage an zuständige Ressortleiter: „Wie viele Tonnen Haifischprodukte wurden in den Jahren 2017, 2018 und 2019 nach Österreich importiert?“ Wie bei einem richtigen Quiz gibt es einige Antworten zur Auswahl:
ZEICHNUNG: GEORG FEIERFEIL

Wirtschaftsministerium: Österreich hat 2017 insgesamt 119 Tonnen, 56 Tonnen im Jahr 2018 und 2019 elf Tonnen importiert.
Gesundheitsministerium: Laut Lebensmittelsicherheitsbericht wird für die drei Jahre die Einfuhrkontrolle von Haifischprodukten mit null angegeben.
Finanzministerium: In den verfügbaren Daten scheinen keine Importe von Haifischprodukten auf. Daraus ergibt sich, dass keine Zölle bzw. keine EUSt eingehoben wurden.
Landwirtschaftsministerium: Bei sogenannten IUU-Kontrollen („illegal, unreported, unregulated“) wurden keine Sendungen zurückgewiesen.
Alles klar? Jedenfalls wird auch hier eine kleine, feine Geschichte über die Verwaltung erzählt
Hochwasser
HIMMEL HEIMAT HÖLLE
Neue Plastikverwertungs-Methode. Polystyrol ist in Joghurtbechern oder Styropor, verrottet nicht. Forschende der Virginia Tech fanden nun eine Upcycling-Methode: Mithilfe eines Katalysators, UV-Licht und Dichlormethan reagiert der Kunststoff zu Diphenylmethan: Ein kaum giftiger Stoff für die Pharma- und Duftindustrie.

Keine Kehrtwende in Sicht. Der Pandemieeffekt ist schon wieder vorbei: Um 4,8 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020 sind die Treibhausgasemissionen 2021 im Land gestiegen, so die Zahlen des Umweltbundesamts. Die gute Nachricht: Um zehn Prozent dürften die Emissionen im Bereich Verkehr im Vergleich zu 2019 gesunken sein.

Fischsterben in der Oder. Noch ist die Ursache unklar, doch fest steht: Seit Wochen sterben Fische, Muscheln und Schnecken entlang der Oder. Die Giftwelle kommt aus Polen, dort haben wohl Chemikalien zu einer toxischen Algenplage geführt, Niedrigwasser und hohe Wassertemperaturen die Umweltkatastrophe noch verstärkt.

42 FALTER 34/22 FOTOS: APA/ROBERT JAEGER, APA/DPA/OLIVER BERG, APA/DPA/PATRICK PLEUL
NATUR
Jetzt versuchen wir, dem Fluss mehr Raum zu geben, damit er das
selbst unterbringen kann. „Alles fließt“, Seite 43
Peter Iwaniewicz wundert sich über flexible Antworten
An der Pinka im Südburgenland wurde ab 2016 ein Abschnitt renaturiert. Der Fluss kann sich nun wieder schlängeln und bei einem Hochwasser das angrenzende Feld überfluten
Alles fließt
Das Life-Iris-Projekt will Österreichs Flüsse renaturieren. Wenn Flussbetten mehr Raum bekommen, profitieren Biodiversität und Hochwasserschutz
Kurz vor der Ortseinfahrt nach Oberwart, versteckt hinter dichtem Gebüsch, liegt eine kleine Schotterinsel, mitten im Lauf der Pinka. Nur Wasserrauschen ist hier zu hören, vereinzelt radeln E-Biker vorbei. Ein Stück wilde Natur, ein Erholungsraum fern der Zivilisation.
Folgt man dem Fluss von hier aus weiter Richtung Ortskern, zeigt sich allerdings ein anderes Bild: Schnurgerade verläuft der Fluss hier bis ins Zentrum, eingekesselt in Steinwände. „Das ist das Schlimmste, was einem Fluss passieren kann“, sagt Helena Mühlmann, Gewässerökologin des Landwirtschaftsministeriums. Sie hat Landschaftsplanung an der Universität für Bodenkultur in Wien studiert. „Das Ökosystem muss immer in Bewegung sein. Ein Fluss gräbt sich Ufer ab, lagert Materialien um und transportiert sie weiter.“ So entstehen Habitate für Insekten, Fische und Pflanzen. Lebensräume, die in einem fixierten, also betonierten Flussbett verschwinden.

Die idyllische Schotterinsel setzte die Gemeinde Oberwart erst vor kurzem in die Landschaft. Zuvor war die Pinka in den 1960er-Jahren begradigt worden, viele Teile des Flussbetts wurden dabei betoniert. Dieser Abschnitt um die Schotterinsel wurde nun renaturiert, das Ufer umgegraben und die ursprünglichen Flussschlingen – sogenannte Mäander – wurden wiederhergestellt. Gesamtkosten: 3,2 Millionen Euro. Mühlmann leitet das Life-Iris-Projekt, das sich ebenjene Renaturierung zum Ziel gesetzt hat. Bund, Länder, Gemeinden und EU finanzieren mit vorerst 16,5 Millionen Euro eine Art Testprogramm. Über neun Jahre werden an acht Pilotgewässern, dar-
Fortsetzung nächste Seite
NATUR FALTER 34/22 43
REPORTAGE: LINA PAULITSCH
FOTO: MARTIN WENK
unter die Donau und die Enns, einzelne Stellen dereguliert und beobachtet. Ähnliche Renaturierungsprojekte sollen später in ganz Österreich umgesetzt werden.
An der Pinka fiel der Startschuss 2016, ein Jahr lang wurde gebaggert. Anhand historischer Pläne versuchten die Flussbauer den ursprünglichen Verlauf wiederherzustellen. Den Rest erledigte der Fluss bald von selbst. Äste, Steine und Schotter spülte das Wasser als kleine Staudämme an. Die seien wichtig, um verschiedene Fließgeschwindigkeiten entstehen zu lassen, erklärt Helena Mühlmann.
„Hier neben der Insel ist ein tieferer Bereich, das Wasser fließt ein bisschen langsamer. Dort sind feinere Sedimente drin, wo Insektenlarven leben. Weiter vorn ist ein Rinner, ein schnell fließender Bereich. Das ist wieder für andere Arten wichtig, gerade für Fische. Die brauchen verschiedene Strömungsbedingungen, um Kinderstuben einzurichten, und für die Larvenaufzucht.“
Die Anzahl und Artenvielfalt der Fische ist generell ein guter Gradmesser dafür, in welchem ökologischen Zustand sich ein Fluss befindet. Sie reagieren sehr sensibel auf Veränderungen ihres Lebensraums. Haben sie keinen Platz zum Laichen oder Flachbereiche, um Jungfische großzuziehen, kann sich der Bestand innerhalb weniger Jahre drastisch verringern. Und verschwindet eine Fischart, ist das Gleichgewicht des Ökosystems insgesamt in Gefahr. Wie viele Fische es gibt, wirkt sich auf Insekten, Vögel, Pflanzen und letztlich den Menschen aus.
Momentan herrschen so niedrige Wasserstände wie seit 500 Jahren nicht mehr. 47 Prozent der europäischen Flächen sind von Trockenheit betroffen, es mangelt an Trinkwasser, die Elbe stellte ihren Fährbetrieb kurzerhand ein. Den Flüssen mehr Bedeu-
tung beizumessen, sie zu hegen und zu pflegen wird nun auch politisch wieder wichtig.
Mehr als die Hälfte der österreichischen Flüsse ist laut Landwirtschaftsministerium in keinem guten ökologischen Zustand. Das bedeutet, dass zu wenige Fische, Algen oder Organismen im Wasser zu finden sind. Bei 95 Prozent dieser Flüsse kam es zu diesen Problemen, weil sie verbaut wurden: begradigt, gestaut oder durch Flussschwellen verlangsamt.
Seit dem Jahr 2000 gibt es die sogenannte EU-Wasserrahmenrichtlinie, die das verpflichtende Ziel hat, alle Gewässer in einen guten ökologischen Zustand zu bringen, diesen zu erhalten und damit die Flora und Fauna in Gewässern zu schützen. „Aber wir
Die Pinka nahe Oberwart. Sie wurde in den 1960er-Jahren reguliert

Der renaturierte Bereich der Pinka, wenige hundert Meter flussaufwärts. Fische, Insektenlarven und Libellen finden hier neue Lebensräume
Wien Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Donau suchte sich damals ihr Flussbett selbst und verfügte über zahlreiche Nebengewässer. Sie durchquerte fünf Kilometer Aulandschaft. Dörfer wie Floridsdorf und Stadlau waren regelmäßig überschwemmt. Ab 1870 begann die Regulierung


kämpfen noch mit einer massiven Menge an Altlasten“, sagt Mühlmann. In Österreich gebe es keinen einzigen Fluss mehr, der vollständig naturbelassen verlaufe; Handlungsbedarf bestehe so gut wie überall. In ganz Europa gibt es nur mehr einen völlig unberührten Wildfluss, nämlich die Vjosa in Albanien. Sie wurde erst vor kurzem unter Naturschutz gestellt.
Aber nicht nur die Tiere und Pflanzen haben ein Problem mit den eingeengten Flussläufen. Auch etwa starke Regenfälle haben in Österreich in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Im Life-Iris-Projekt arbeitet Helena Mühlmann deshalb mit Martin Wenk zusammen, einem studierten Geografen, der im Landwirtschaftsministerium für Hochwasser-Risikomanagement zuständig ist. Je geradliniger ein Fluss verlaufe, desto mehr beschleunige das Wasser und schieße irgendwann mit voller Wucht aus dem Flussbett heraus. „Ein renaturierter Bereich, wo der Fluss in die Breite gehen kann, ist aus Hochwassersicht sehr sinnvoll“, sagt Wenk.
Über Jahre hinweg war es aber gerade der Hochwasserschutz, der den Eingriff in die Flussnatur legitimierte. Ein „schnürlgerades, betoniertes Gerinne, wo das Wasser möglichst schnell herausrinnt“, sei das Dogma gewesen, so Wenk. Heute habe ein Sinneswandel stattgefunden. „Jetzt versuchen wir dem Fluss mehr Raum zu geben, damit er das Hochwasser selbst unterbringen kann. Er darf ruhig fluten. Nicht überall, aber dort, wo er keinen Schaden anrichtet.“ Ein Beispiel dafür ist der Lech in Tirol. Um sich ausdehnen zu können, vergrößerte man das Flussbett um ganze 32 Fußballfelder, 7000 Meter Längsverbauungen wurden entfernt. So entstanden neue Laichgewässer für Fische, Amphibien und Libellen. Verschwundene Pflanzenarten, wie
44 FALTER 34/22 NATUR
FOTOS: LINA PAULITSCH; KARTE: JOSEPHINISCHE_LANDESAUFNAHME WIEN/GEMEINFREI
Fortsetzung
von Seite 43
der Zwergrohrkolben, wurden wieder angesiedelt. Sind begradigte Flüsse also immer reine Bausünden? Damals hätten eben andere moralische Argumente gesiegt, sagt Gertrud Haidvogl, Umwelthistorikerin an der Universität für Bodenkultur Wien. Für die Flussbauer ging es damals um bessere Mobilität. Und darum, die Bevölkerung mit Lebensmitteln versorgen zu können.



„Mit der Industrialisierung, ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, entwickelte sich ein Glaube an den Erfolg von Technik. Man hat damals gedacht, man wird die Flüsse, unabhängig von ihrer Größe, bändigen können“, so die Historikerin. Vor 150 Jahren beschränkte sich die Regulierung zunächst auf Uferbefestigungen. Mit Pflöcken und Pfählen versuchte man, die Flüsse in ihrem Bett zu halten. Als die Schiffe immer größer wurden, begann man, die neuen Transportwege zu verbreitern und eng beieinanderliegende Mäander zu planieren.

Im 20. Jahrhundert bauten viele Städte ihren Hochwasserschutz komplett aus. Dämme, neue Flussbetten und stillgelegte Altarme veränderten das Landschaftsbild. Die Stadt Wien schaffte etwa 1870 ein Überschwemmungsgebiet der Donau und bündelte das weitverzweigte Augebiet zu einem Hauptarm. Die Stadt vollendete die Wiener Donauregulierung in den 1970erJahren mit der Donauinsel. Die Donauinsel ist ein sogenanntes Entlastungsgerinne. Zwar zerstörte es frühere Habitate für Tiere und Pflanzen, schützt die Hauptstadt aber bis heute zuverlässig vor Hochwassern. Renaturierungen sind in großen Städten also kaum möglich. Begradigt wurden auch die kleineren Flüsse spätestens
in den 1950er- und 60er-Jahren. „Es ging damals um Nahrungsmittelknappheit“, erklärt die Historikerin Haidvogl. „Da sich die Flüsse nicht mehr schlängelten, wurde viel Platz frei. Diesen gewonnenen Boden konnten die Bauern zum Anbau nutzen.“ Als „zehntes Bundesland“ bezeichnete die Wasserbauzeitschrift 1948 stolz die neuen Ackerflächen.
Das alles wieder zurückzubauen ist deshalb nicht nur technisch herausfordernd. Die größte Hürde sind die aktuellen Grundbesitzer, zumeist Landwirte, die man überzeugen muss, ihr Land abzutreten. Bund und Gemeinden kaufen den Grund zurück. „Dadurch dauert es irrsinnig lange“, sagt Martin Wenk vom Life-Iris-Projekt. „Eines unserer Pilotgewässer ist die Leitha. Dort haben wir 350 Grundeigentümer – und von allen brauchen wir ein kleines Stückerl. Als Erstes mussten wir also alle an einen Tisch bekommen und ein Tauschkonzept erstellen.“
Bei Renaturierungen versuchen die Gemeinden häufig, den Landwirten einen alternativen Grund an einem anderen Ort anzubieten und gegen ihr Flussufer zu tauschen. Dieser Verhandlungsprozess dauert oft mehrere Jahre.



















Überhaupt seien verschachtelte Zuständigkeiten in den Gemeinden das Hauptproblem beim Renaturieren, klagt Wenk. So wie beim Umweltschutz generell. Wird ein Fluss baulich verändert, ist in Österreich die Gemeinde nicht nur Bauherr, sondern auch Eigentümer. Das bedeutet, dass übergeordnete raumplanerische Konzepte sehr schwer umzusetzen sind. „Als Landwirtschaftsministerium haben wir limitier-
te Möglichkeiten. Eigentlich muss die Gemeinde auf uns zugehen und ihren Fluss verändern wollen.“ Das passiere zumeist dann, wenn es um Hochwasserschutz gehe. Ihr Ziel sei es, sagt Mühlmann, Bürgermeistern auch ökologische Maßnahmen schmackhaft zu machen.

Langfristig profitieren auch die Landwirte von der Natur rund um ihre Felder. Denn verbaute Flüsse steigern auch den Bewässerungsbedarf. Je schneller ein Fluss fließt, desto tiefer gräbt er sich in den Boden –und desto stärker sinkt der Grundwasserspiegel. Damit wird die Erde trockener, die Brunnen liegen tiefer und müssen von den Bauern neu abgegraben werden.
Auch die steigenden Temperaturen haben mit den begradigten Gewässern zu tun. Könnten mehr Flüsse aus ihrem Betonbett heraus, würde es zumindest ein bisschen weniger heiß. Vor der globalen Erderwärmung kühlten Aulandschaften das Klima herunter. In Wiesen und Wäldern mit kleinen Nebengewässern konnte das Wasser versickern und verdunsten, die Umgebung wurde feuchter. Bis das wieder der Fall ist, wird es noch dauern. Eine „Mammutaufgabe“ erwarte die nächsten Generationen, sagt Helena Mühlmann. Um verbaute Landschaften wieder natürlich zu machen, brauche es „extrem viele Maßnahmen und Milliarden von Euro“.








An der Pinka joggen zwei Männer vorbei, sie kühlen ihr Gesicht im Wasser. Früher hätten sie diesen Flussabschnitt gar nicht registriert, erzählen sie, jetzt kämen sie gerne auf die Schotterinsel. Mühlmann gräbt im Wasser im Sand, sie entdeckt kleine Krebse. Ein gutes Zeichen, sagt sie. F


NATUR FALTER 34/22 45
FOTOS: PRIVAT (3) Eins für alle, die länger fahren wollen. Bezahlte Anzeige des Klimaschutzministeriums. klimaticket.at Aktionszeitraum für KlimaTicket Ö Neukund:innen bis 31.12.2022 Jetzt beim KlimaTicket neu einsteigen oder verlängern, KlimaMonat abholen und ein 13. Monat gratis fahren.
GRATIS KLIMAMONAT 700030_KT_Anzeige_13Monat_216x145ssp_ISOnp_Falter.indd 1 07.07.22 17:15
Eine Initiative des Klimaschutzministeriums.
Gertrud Haidvogl ist Umwelthistorikerin an der Boku, Schwerpunkt Flussgeschichte
Helena Mühlmann leitet das Life-IrisProjekt. Sie ist Gewässerökologin
Martin Wenk, studierter Geograf, ist bei Life Iris zuständig für Hochwasserschutz
Phettbergs Predigtdienst Sargnägel
 Phettberg
Phettberg
Radiohören ist mein Universitätsstudium
Evangelium des 21. Sonntags im Jahreskreis, Lesejahr C: „Viele werden versuchen hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen.“ (Lk 13,22–30)
Zum heutigen Evangelium freu ich mich, dass der Oberste Gerichtshof beschlossen hat, dass das Mädchen Tina aus Georgien nach Österreich zurückkehren darf und die großartige Leiterin der Kindeswohlkommission, Irmgard Griss, das Kindeswohl in Österreich im Auge hat.
Und der Attentäter, der Salman Rushdie in einer Buchhandlung in Chautauqua, New York, schwer verletzte, staunte nachher, dass Salman Rushdie überlebt hat. Auf jeden Fall wird die göttliche Dreifaltigkeit Salman Rushdie umarmen und diesen Attentäter in die Hölle schmeißen!
Meinen Sachwalter hab ich gebeten, dem schrecklichen Verein Radio Maria jedes Jahr 100 Euro zu überweisen, denn ich sterbe jetzt ohne Radio, und nur dieses Radio Maria unterhält mich. Dank meines göttlichen Engels Hannes besitze ich nun einen Computer-Anstecker, mit dem ich mir drei Sender einspeichern kann: Ö1, Radio Burgenland und Radio Maria.


Wenn ich dann gestorben sein werde, würde meinereins im Jenseits mit Abraham, Isaak und Jakob jausnen können? Gibt es dort oben ein göttliches Bedienungspersonal?
Mein Hauptschul-Niveau steckt noch immer in mir. Radio Maria sendet jeden Dienstag einen Vortrag über Philosophie. Zuletzt war wieder „mein“ Philosophieprofessor Dr. Peter Egger zu hören, er redete über den Neomarxismus, die 68er-Bewegung und den großen Philosophen Jürgen Habermas, der mit Kardinal Ratzinger einmal einen Auftritt hatte.
Der ehemalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl ist kein Freund des Neomarxismus, sagte er in der Wiederholung der Sendung „Im Gespräch“ auf Ö1: „Die Sozialdemokratie hat allen Versuchungen widerstanden, auf dieses eher ja menschenfeindliche Weltbild des Neoliberalismus hineinzufallen, ohne jetzt die Marktwirtschaft zu verdammen, der Neoliberalismus ist eigentlich antimarktwirtschaftlich, das muss man ja auch eimal sagen in der Deutlichkeit.“
Mein Radiohören ist quasi mein „Universitätsstudium“. Und da schnappe ich so Worte wie „Neomarxismus“ Gott sei Dank auf.
Phettbergs Predigtdienst ist auch über www.falter.at zu abonnieren. Unter www.phettberg.at/gestion.htm ist wöchentlich neu zu lesen, wie Phettberg strömt
Fragen Sie Frau Andrea Informationsbureau
Sekkieren Sie noch oder nerven Sie schon?
Andrea Maria Dusl beantwortet seit 20 Jahren knifflige Fragen der Leserschaft
Liebe Frau Andrea, der Autor David Baum hat mich auf Ihre Kolumne aufmerksam gemacht. Er hatte recht, als er sagte, das wird Dir gefallen. Ich bin Hobby-Wiener und genieße die Stadt mit angemessenem Abstand. Manchmal tauche ich dann aber doch ein. Das Wort „sekkant“ ist mir erschienen. Zwei Fragen: Ich wäre gern sekkant, was muss ich tun? Wo könnte mir dieses Wort begegnet sein? Ich habe es nicht gehört, ich habe es gelesen, weiß aber nicht mehr, wo. Wahrscheinlich liebe ich Wien.
Liebst & Herrlich, Friedrich Liechtenstein, Berlin-Mitte, Guten Morgen! Per E-Mail
er mich neulich genervt). Das von Ihnen in Kaffeehausliteratur, möglicherweise auch in journalistischer Prosa aufgelesene „sekkant“ ist das Adjektiv zum Zeitwort sekkieren.
Wir wären versucht, eine Verwandtschaft zur Sekante zu erblicken, jener Linie, die einen Kreis oder eine andere Kurve schneidet, wüssten wir es nicht besser.
Kommt doch sekkieren nicht von schneiden (italienisch und lateinisch secare), sondern von verdorren, austrocknen, trocknen (italienisch seccare, lateinisch siccare). In seiner Nebenbedeutung verstehen die Italiener unter „seccare“ belästigen, auf die Nerven gehen.
comandantina.com; dusl@falter.at, Twitter: @Comandantina
Lieber Friedrich, wollte man in Wien zum Ausdruck bringen, jemand nerve, sei aufdringlich, lästig, griffe man zum bestens bekannten Verb sekkieren. In Sätzen wie diesen: „Da Schef sekíad mi ollaweu mid blede Dands!“ (Der Chef belästigt mich immer mit dummen Ideen!).
Eskalationen auf diesem Gebiet quittierte man mit Feststellungen wie „bis aufs Bluad hoda mi neilich sekíad“ (bis aufs Blut hat
Das Wienerische hat aus dem italienischen seccare sekkieren gemacht und mit ihm auch einen verwandten Ausdruck importiert. Aus seccatura, der Belästigung, wurde die Sekkatur (ausgesprochen: Sekadúa), in weiterer Folge die Sekkiererei (Sekíararei).
Von Ihrem Vorhaben, sekkant zu sein, möchte ich dringend abraten, allzu leicht „gabads a Gfret“, gäbe es ein Gefrett (Ärger, Plage, Unannehmlichkeit). Vermeiden Sie Sekkaturen jeder Art! Eine übliche Quittung bliebe Ihnen erspart: „Gwööns wen ondan!“ (Quälen sie jemand anderen!)
46 FALTER 34/22
Hermes
führt seit 1991 durch das Kirchenjahr
ILLUSTRATION: STEFANIE SARGNAGEL
Doris Knecht Selbstversuch
Hm, okay, ist uns glaub ich wuascht
Weil ihr nach dem Hund gefragt habt: Geht ihr gut! Schläft unterm Tisch, springt begeistert Freundinnen an, buddelt beeindruckende Löcher in die Wiese, in denen man sich gut die Knöchel brechen kann. Wenn man sie zuschaufelt, buddelt sie daneben ein neues. Man merkt sich also einfach, wo die Löcher sind und abends, wenn Gäste kommen, stellt man Teelichter hinein, damit die sich nicht die Knöchel brechen, während der Hund sie anspringt. Jaaaah.
Wir trainieren eh Gelassenheit sowie Spazierengehen an der lockeren Leine und Nicht-jeden-Hund-Anbellen, dem wir begegnen. Bitte, sie kann auch einiges: problemlos und still allein daheim bleiben, dabei keine Schuhe und nichts anderes zerbeißen, nicht mehr jeden anbellen, der am Gartentor vorbeigeht, beim Essen nicht betteln und High Five. Der Rückruf sitzt auch einigermaßen.
Das mit dem Bellen und Anspringen wird schon, sagen die Nachbarn, wart bis sie noch ein bisschen älter ist. Ich warte doch eh! Was, glaub ich, nichts mehr wird, ist das mit der Begeisterung fürs Autofahren. Alles ausprobiert. Immerhin, sie übergibt sich nur noch jedes achte oder neunte Mal, die Chance lebt. Ach ja, blad ist sie auch nicht mehr, das war nur eine Phase, ihr braucht sie nicht mehr bodyshamen, – ja, talkin’ to you, G.!
Es ist jetzt schon dunkel am Abend und ich begrüße das. Für Early-Schlafengeherinnen wie mich ist der August der beste Monat im Jahr: Es ist noch Sommer, es ist noch warm, die Paradeiser sind reif (nicht meine, die vom Horwath, ich hab heuer kei-
Doris Knecht ist gespannt wie ein Seilbahnkabel

ne), die Zwetschken, die Subira und ein paar frühe Apfelsorten, man kommt mit blauen, brombeersüßen Händen vom Morgenspaziergang. Wenn man um sechs aufwacht, ist es draußen hell, wenn man um neun vor der Tür sitzt, sieht man Sterne und, wenn man Glück hat, ein paar Sternschnuppen. Mehr regnen sollte es, aber sonst kann es gern so bleiben von der Jahreszeit her.
Wäre auch wegen dem Heizen und dem Strom gut. Meine vierteljährlichen Stromvorauszahlungen haben sich fast verdoppelt. Es graut mir vor dem Winter: So vielen Familien in Österreich wird es schlecht gehen, so viele Kinder werden frieren. Ich bin jetzt schon gespannt, wer von den angekündigten Hilfen wieder profitieren wird, wer an unserem Steuergeld wieder fett verdient. Wir sind in Österreich – kaum denkbar, dass es diesmal anders sein wird.
»Immerhin, ich habe gelesen, der Tiroler Seilbahnsprecher „erwäge“ beim Wintersport in Tirol zu sparen. Man ist gespannt wie ein Seilbahnkabel, wie diese Erwägungen wohl ausgehen.
Ich bin jetzt schon gespannt, wer von den angekündigten Hilfen wieder profitieren wird, wer an unserem Steuergeld wieder fett verdient
List Stadtstreife
Es war eine sehr wienerische Woche. Der Tod ist mitgeschwungen. Jemand aus dem erweiterten Kreis der Familie. Alles kompliziert, kaum Kontakt in den vergangenen Jahren. Vor allem politisch Lichtjahre auseinander. Als die Nachricht darüber bekannt wurde, tat vor allem das Leid derer weh, die ihn gerne gehabt haben, die Kinder und die Enkel.
Man hat sich vorgestellt, wie er gelebt hat, so in der Pension. Hie und da wohl Besuch. Sonst vor dem Fernseher, wahrscheinlich polternd über die vielen Fremden, die „das Land plündern“ und „die Kultur unterwandern“. Und was man halt so denkt als Rechter. Kaum Freunde wohl. Na ja.
Ich war nicht auf dem Begräbnis, es schien mir nicht passend aufgrund der vielen Dispute zu Lebzeiten. Aber danach wurde mir davon erzählt. Es waren viele Leute bei der Feier. Und es sei schön gewesen, was die Leute zu erzählen hatten. Er war in einer Wandergruppe. Und in einer Fahrradgruppe.
Die eine oder andere Dame war dabei. Sie waren Freundinnen und auch mehr. Erzählten von seinen großen Reisen in alle Welt. Kanada oder Kenia. Er habe die Enkel vom Kindergarten abgeholt, wöchentlich. Habe

Heidi List betrachtet die Wiener und lässt uns mitschauen.
Diesmal: am Fluss
Apropos Tirol, die Mitterer-Geschichte amüsiert mich so. Der Autor der „Piefke-Saga“ sollte dem Land Tirol eine „TourismusAbgabe“ zahlen. Eine Tourismus-ABGABE! Die Kulturschaffenden sollen den größten Tiroler Wirtschaftszweig UNTERSTÜTZEN! Hahaha. Mitterer zieht jetzt weg.
Ein anderer bekannter, deutschsprachiger Schriftsteller hat dieser Tage geäußert, er halte nicht viel vom Gendern, und was soll ich sagen: Ja. Okay. Is ma wuascht.
DER KIN TIP PS
immer ein offenes Haus gehabt, auch wenn es schwierig war mit den Beziehungen zum einen oder anderen.
Aber das Haus blieb offen. Und er habe gekocht, für die Vinzirast. Einfach so. Dienst an der Gesellschaft, auch wenn er da wohl auch ein paar von den „Fremden“ zu versorgen hatte.
Das war bewegend zu erfahren. Und erstaunlich. Man stellt sich die Leute in dem Zustand verharrend vor, in dem man sie aus den Augen verloren hat. Nun ist bei mir ein Gefühl der Achtung für ihn aufgekommen. Und das war, muss ich zugeben, sehr schön. Viel besser als Empörung.
Zu traurigen Gedanken passt ein Spaziergang am Wienfluss. Er ist dieser Tage ohnehin nur ein Rinnsal. Da und dort sieht man Inschriften am Boden. „Ruhe sanft“ steht da. Oder „In Liebe“. Alte Grabsteine wurden beim Bau des Flussbetts Ende des 19. Jahrhunderts einfach als ergänzende Materialien verwendet. Man liest Namen, „Mathilde“ oder „Franz“ Einer hieß „Dolfi Rosnberg“. Ein unmöglicher Name, wenn man bedenkt, wie sich die Geschichte dann entwickelt hat. Und man liest Jahreszahlen. So banal ist der Tod.
Ruhe auch du sanft, lieber H. Du hättest es wohl gehasst, im Falter erwähnt zu werden. Oder, wer weiß, vielleicht auch nicht mehr. Respekt.
KIND IN WIEN

Informationen über das Angebot an Kultur-, Freizeitund Sportaktivitäten für Kinder in Wien und Hilfe für Notfälle. 480 Seiten, € 18,50
faltershop.at | 01/536 60-928 In Ihrer Buchhandlung
KOLUMNEN FALTER 34/22 47
Heidi
RESPEKT








































































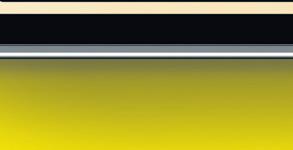







EINFACH BEZAHLEN. RAIFFEISEN MIT APPLE PAY. RAIF_Applepay22_216x315ABF_RZ.indd 1 01.08.2022 09:27:44





























































 EINZIGES KATASTROPHENGEBIET
EINZIGES KATASTROPHENGEBIET
































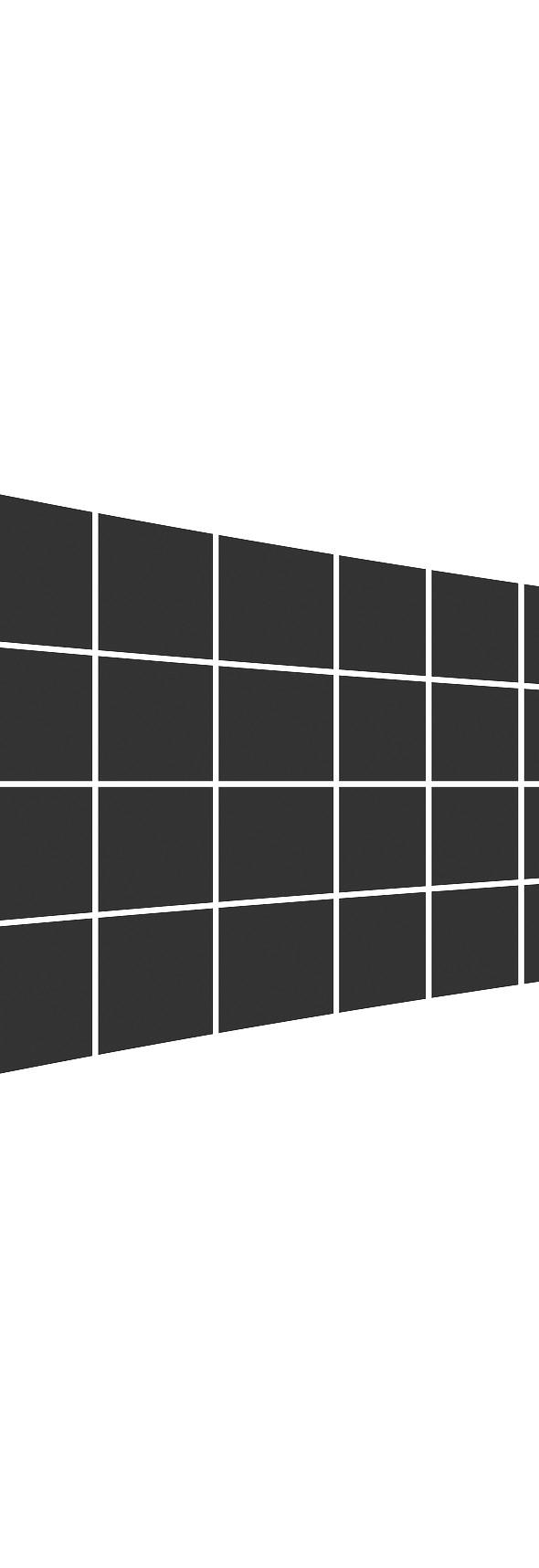


























































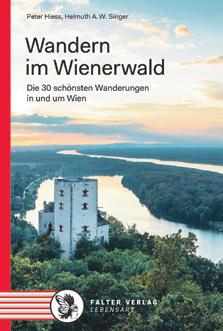











































 Phettberg
Phettberg